Standardfragen zum Schwarzweiß-Fotolabor
Eine Hilfestellung nicht nur für Anfänger
Hier direkte Links zu häufig wiederholten Themen in den einschlägigen Foren:
• Wie kriegt man den Film in diese Mist-Spirale?
• Ist ein Stoppbad notwendig?
• Wo bekomme ich Ersatz für die Quecksilberbatterien?
Die gesamte SWFAQ als pdf-Download habe ich wieder rausgenommen! Weil die Inhalte natürlich ständig aktualisiert und bei neuen Ideen erweitert werden, war das immer nur eine kurzlebige Momentaufnahme. Zum gelegentlichen Nachschlagen empfehle ich, diese Original-SWFAQ in Ihre Browser-Lesezeichen zu übernehmen.
Allgemeine Fragen zum Hobbylabor
• Wozu braucht man heute überhaupt noch ein eigenes Fotolabor?
• Wo gibt es Hilfe? - Mit Tipps für echte Anfänger!
• Wo kann man das Zeug heute noch kaufen?
• Was kostet die Fotografie auf Film heute?
Fragen zu Film und Negativ
• Welcher Entwickler ist der beste?
• Welcher Schwarzweißfilm ist der beste?
• Lohnt sich SW-Film als Meterware?
• Wie kriegt man den Film in diese Mist-Spirale?
• Muss man Film vor dem Entwickeln vorwässern?
• Sollte man Film nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums noch verwenden?
• Wie vermeide ich Trockenflecken auf dem Film?
• Ich habe den XX-Film auf ISO-yy belichtet. Wie lange muss ich entwickeln?
• Film A ist okay, aber warum hat Film B immer zu wenig Kontrast?
• Was versteht man unter dem gamma-Wert eines Films?
• Warum soll ich meinen SW-Film eintesten?
• Was ist eigentlich das „Zonensystem“?
• Was bewirkt eine Vorbelichtung des Films?
• Wie funktioniert „Pushen“?
• Entwicklungsfehler und deren Vermeidung
Fragen zu Fotopapier und Positiv
• Welches Fotopapier ist zu empfehlen?
• Welchen Entwickler nehme ich für mein Fotopapier?
• Wie lange muss Fotopapier entwickelt werden?
• Wie lange kann man SW-Papier lagern?
• Ich brauche noch einen Vergrößerer - aber welchen?
• Welches Vergrößerungsobjektiv brauche ich?
• Brauche ich zum Vergrößerungsgerät einen Scharfsteller?
• Welche Schärfentiefe habe ich beim Vergrößern?
• Welche Dunkelkammerlampe brauche ich?
• Wie dunkel muss meine Dunkelkammer sein?
• Wie reinige ich den Belag in der Entwicklerschale?
• Was ist bei Ausstellungsbildern zu beachten?
• Wie funktioniert Variokontrastpapier?
• Was ist das Splitgrade-Verfahren?
• Brauche ich einen Laborbelichtungsmesser?
• Wie kann ich mein Fotopapier eintesten?
Fragen, die Film und Papier betreffen
• Wie genau muss ich die Entwicklertemperatur einhalten?
• Welches Fixierbad brauche ich für Film oder Papier?
• Wie lange muss ich / darf ich fixieren?
• Ist ein Stoppbad notwendig?
• Wie lange muss ich wässern?
• Wie gesundheitsschädlich ist Fotochemie?
• Wohin mit den verbrauchten Chemikalien?
• Was ist bei Ansatz und Lagerung von Pulver-Entwicklern zu beachten?
• Wie lange halten Entwicklerkonzentrate?
Sonstige Fragen zur Fotografie im weiteren Sinne
• Welches Stativ ist das beste?
• Wo bekomme ich Ersatz für die Quecksilberbatterien?
• Wie finde ich ein Negativ in meinen Ordnern?
• und als Abschluss: Gerüchte, die ich nicht bestätigen kann!
Hier die Standardantworten …
… auf alle diese Fragen, teilweise als objektive Feststellung nach intensiven Recherchen („Das ist einfach so!“), teilweise meine Meinung, die auf eigenen Erfahrungen beruht. Was ich hier empfehle, hat sich einfach nach jahrelanger Hobbypraxis für mich persönlich bewährt. Es ist nicht auszuschließen, dass anderswo etwas anderes empfohlen wird. Da ich bisher noch keine Proteste erhalten habe, scheine ich zumindest nicht ganz falsch zu liegen. Vor allem die Fragen bezüglich →Entwickler, →Stoppbad oder Vermeidung von →Trockenflecken werden immer kontrovers diskutiert. Jeder hat wohl seine eigene bewährte Methode, die manchmal mit religiösem Eifer verteidigt wird.
Da man vor der Laborarbeit erst mal einen richtig belichteten Film braucht, habe ich dazu auch etwas geschrieben, siehe →Belichtungsmessung. Nicht etwa, weil darüber noch nicht genügend geschrieben wurde, sondern weil viel Unfug kursiert, den ich hier ein bisschen zurechtrücken möchte ;-)
Wichtig: Absolut entscheidend für ein gutes Foto ist, ein Motiv zu erkennen, eine geplante oder intuitiv richtige Bildgestaltung oder auch der richtige Moment. Die Technik wird meist überbewertet und ist bei Weitem nicht so kompliziert, wie der Umfang dieser Seite vermuten lässt.
In einem Fotoforum hat jemand mal sehr zutreffend geschrieben: „Ich bin erstaunt, dass ich in der Lage war, ohne Probleme Filme zu entwickeln, bevor es Internet und Fotoforen gab. Wenn ich damals gewusst hätte, welche Fehler man dabei machen kann, hätte ich vielleicht nie mit der Fotografie angefangen.“ Fotografie mit SW-Film und Fotolabor ist erstaunlich tolerant gegen Fehler. Mit sorgfältiger Arbeitsweise und ein bisschen Experimentierlust kann man schnell zurechtkommen. Als Anfänger ist man eventuell schon zufrieden, dass auf dem Film überhaupt was drauf ist. Für einen “fine-art print”, auf den man stolz sein kann, muss man aber die Technik im Griff haben, sonst bleibt ein solches Foto ein Zufallsergebnis, und es stellt sich bald Frust ein. Die notwendige Ausrüstung ist schnell besorgt und ist nicht teuer. Viele technische Hilfsmittel, die ich in meinen Ausführungen anspreche, sind nicht existenziell wichtig - eher “nice to have”. Man braucht aber Zeit, um eigene Erfahrungen zu sammeln und die vorhandene, eigene Ausrüstung optimal zu nutzen.
Diese Internet-Seiten sind unter anderem deshalb so umfangreich geworden, weil ich selbst hier auf das Ergebnis meiner eigenen Recherchen und Erfahrungen von überallher und schnell zugreifen kann. So hat es zumindest vor vielen Jahren angefangen. Dass Andere auch für nützlich halten, was ich geschrieben habe, ist ein Nebeneffekt, der hoffentlich hilft, die Fotografie auf SW-Film wieder ein bisschen weiter zu verbreiten.
Wozu braucht man heute überhaupt noch ein eigenes Fotolabor?
Diese Frage kann ich nur sehr subjektiv beantworten: Weil mir die handwerkliche Arbeit in der Dunkelkammer Spaß macht!
Ich brauche mein Hobby nicht damit zu rechtfertigen, dass die analoge SW-Fotografie gegenüber der digitalen billiger ist oder bessere Ergebnisse bringt. Vielleicht trifft das zu wie z.B. bei gut gemachter Dia-Projektion, wahrscheinlich verhält es sich aber genau anders herum - mir ist das egal. Meine ehrliche Antwort auf diese erste Frage lautet daher: Wer mit seiner Digitalkamera und seinen digitalen Arbeitsabläufen zufrieden ist und damit gute Bilder zustande bringt, der braucht heute tatsächlich kein Fotolabor mehr.
Wer dagegen meint, er bräuchte unbedingt die neueste digitale Technik, um damit in Echtzeit seine Selfies in soziale Netzwerke hochzuladen, dem würde ich dringend die Beschäftigung mit analoger Fotografie empfehlen. Dieser Schritt wäre ein würdiger Abschluss einer pubertären Phase, die einem später ohnehin nur peinlich sein wird.
Dann gibt es noch die sogenannten Hybrid-Fotografen, die auf Film fotografieren, möglicherweise gerade noch den Film selbst entwickeln, aber den Rest per Filmscanner und Bildbearbeitung am PC erledigen. Denen entgeht natürlich der interessanteste Teil dessen, was analoge Fotografie ausmacht - schade! Vielleicht kann ich mit meinen Ausführungen dem einen oder anderen aus dieser Gruppe Appetit auf mehr machen.
Wo gibt es Hilfe?
Früher war das alles ganz einfach: Es gab in den meisten Schulen eine Fotogruppe, Kurse in den Volkshochschulen und Foto-Clubs. Heute ist dort fast alles digital verseucht, und um die wenigen analogen Hobby-Fotografen kümmert sich kein Schwein. Man muss sich also selbst zu helfen wissen.
Als ich nach einer mehrjährigen Fotolaborpause wieder zu meinem alten Hobby zurückgekehrt bin, habe ich mir fest vorgenommen, nie wieder mit viel Frust herumzupfuschen (irgendein Bild ist ja auch immer dabei herausgekommen), sondern ab sofort meine Prozesse genau zu kalibrieren und zumindest halbwegs reproduzierbar zu arbeiten. Als Erstes machte ich mich auf die Suche nach einem aktuellen Fotolabor-Fachbuch. Anfang 2004 bin ich leider nicht fündig geworden. Die Bücher von Otto Croy oder Günter Spitzing waren mir zu alt, dafür bin ich bei meinen Internet-Recherchen auf das Phototec Hobbylabor-Forum gestoßen. Zusammen mit den damals noch laufend erschienenen Kolumnen von Thomas Wollstein im Schwarzweiß-Magazin hatte ich dort Zugriff auf einen unermesslich reichen Erfahrungsschatz anderer SW-Fotografen. Die damaligen Diskussionen sind auch die Basis für meine heutigen Tipps.
Die derzeit lebhaftesten deutschsprachigen Diskussionen über analoge Fotografie findet man wohl im aphog-Forum. Leider gibt es dort einige Platzhirsche, deren Hobby vor allem das Schreiben von Forenbeiträgen ist. Wovon ich einem blutigen Anfänger daher abrate, ist, eine Anfängerfrage in einem Internetforum zu stellen. Natürlich lebt ein Forum von solchen Fragen und man wird reichlich Antworten erhalten. Weil natürlich jeder seine individuelle Methode empfiehlt oder im schlimmsten Fall nur ahnungslose Vermutungen äußert, werden sich diese Antworten in vielen Punkten widersprechen und einen total verwirrten Fragesteller hinterlassen. Also empfehle ich, zunächst das hier Geschriebene zu befolgen. Nach den ersten 5 Filmen fällt es dann auch leichter, in einem Forum eine konkrete und sinnvolle Frage zu stellen und nicht schon wieder: „Welcher →Film oder →Entwickler ist der beste?“ Für Anfänger empfehle ich zunächst folgende Links:
• Analoge-Fotografie.net, leider mit viel Werbung, aber eine Anfänger-taugliche und schön bebilderte Einführung, die hoffentlich dazu animiert, mit der Fotografie auf Film anzufangen.
Wie entwickelt man einen Film?
• Phototec-Infomagazin,
die ersten Schritte für echte Anfänger - oder
• Anleitung zur Filmentwicklung
(PDF-Datei) von Stefan Heymann.
Mehr als in diesen zwei inhaltlich ähnlichen Beschreibungen steht,
muss man nicht wissen, um erfolgreich die ersten Filme zu entwickeln. SW-Filmentwicklung ist zunächst einfach,
und auf den ersten selbst entwickelten Filmen muss auch noch nicht der Super-Fineprint drauf sein.
Hier gibt es noch mehr technisches Wissen für leicht Fortgeschrittene:
• www.Schwarzweiss-Magazin.de
Diese unerschöpfliche Wissensquelle mit den Rubriken „Kurse“ (z.B. zum Zonensystem) und
„Wollsteins Kolumne“ wurde im Februar 2012 leider vom Netz genommen.
Mittlerweile haben diese Seiten bei Fotoespresso
eine neue Heimat gefunden.
Wenn man die Technik beherrscht, findet man hier Gestaltungstipps:
• Schöner fotografieren,
Texte zur Fotografie von Andreas Hurni und Michael Albat
• Tutorials von Hauke Fischer
• oder der Klassiker: Andreas Feininger „Die hohe Schule der Fotografie“,
gibt es sogar als Taschenbuch-Neuauflage
und den Link zur nächsten Buchhandlung erspare ich uns hier.
Wer sich versehentlich auf meine Seite verirrt hat, und doch lieber weiterhin digital fotografieren will, der sollte diese Seite kennen: Cambridge in Colour. Das ist zwar auf Englisch(USA), aber einen vergleichbar guten deutschsprachigen Fotokurs kenne ich (noch) nicht. Dort werden allgemeine Fragen zur Technik ebenfalls gut erklärt, weil selbstverständlich auch Digitalkameras Objektiv, Blende und Verschluss brauchen.
Das sollte als Lesestoff genügen, für alles andere gilt: Übung macht den Meister! Fotografie ist ein Lehrberuf und ein Kunsthandwerk. Bevor man auch nur annähernd Kunst erzeugen kann, muss man das Handwerk einigermaßen beherrschen. Ich wage es nicht, hier über Kunst zu schreiben, aber ich hoffe, handwerkliche Ratschläge geben zu können.
Noch zwei abschließende Bemerkungen in diesem Zusammenhang:
• Was man bei Wikipedia zu Fotolabor-Prozessen lesen kann,
ist entweder veraltet oder eine unbrauchbare Banalität.
• Die Fähigkeit, längere Texte lesen zu können, beherrschen leider nicht mehr alle.
Dem Trend zum funktionalen Analphabetismus folgend, müsste ich mich Twitter-mäßig kurz fassen,
in einfachem Deutsch schreiben und für alle meine Artikel hier ein Video-Filmchen auf YouTube oder TikTok hochladen.
Weil ich aber weder Follower noch Likes sammle und auch nichts damit verdienen will,
werde ich das nicht machen. Diese Kriterien taugen äußerst selten als Qualitätsmerkmal.
Daher empfehle ich ernsthaft, sich lieber an meine FAQ zu halten ;-)
Wo kann man das Zeug heute noch kaufen?
In einem ehemals renommierten Fotogeschäft: „Ich hätte gern einen Kleinbildfilm Kodak TriX!“ - „Äh, wie bitte, ham wir nicht, könn’ wir Ihnen aber sicher bestellen, äh, warten Sie, ich muss mal nachfragen!“ Dort nach Material fürs Fotolabor zu fragen, wäre völlig sinnlos.
In den wenigen verbliebenen Fotogeschäften meiner gar nicht so kleinen Heimatstadt Augsburg geht da also so gut wie gar nichts. Nur in den überall anzutreffenden Drogeriemärkten gibt es noch ein kleines Angebot an Standardfilmen. Da möchte ich auch nicht den Händlern die Schuld geben. Für ein normales Ladengeschäft wäre ein analoges Angebot ein reines Hobby, bei dem nichts zu verdienen ist. Großstädte haben einen Vorteil, dort gibt es evtl. einen oder zwei Händler, die in einer versteckten Ecke für Notfälle noch ein stark geschrumpftes und gut abgelagertes Standardsortiment bereit halten. Das volle Angebot hat man dagegen im deutschen Versandhandel, wo es sogar noch richtig und reichlich Konkurrenz gibt, z.B. digitfoto, fotobrenner, fotoimpex, fotomayr, macodirect, moersch-photochemie, monochrom, nordfoto, photo-lang, … Diese alphabetische Aufzählung ist sicher unvollständig, sowie ohne diejenigen Versender, die nur an gewerbliche Abnehmer verkaufen. In Österreich fallen mir spontan blende7 oder fotofachversand ein, in der Schweiz ars-imago. Auf anklickbare Internetadressen verzichte ich hier, einfach an die genannten Namen die Länderdomain .de (.at oder .ch) anhängen. Im Gegensatz zu früher muss man jetzt eben seine Einkäufe ein bisschen vorausplanen, aber es ist alles problemlos zu kriegen.
Was kostet die Fotografie auf Film heute?
Kameras und Objektive: Von Laien höre ich immer wieder, dass so exotisches „Zeug“ doch sicher richtig teuer und kaum noch zu kriegen sei. Denkste! Es muss ja nicht gleich eine Leica sein, meines Wissens die letzte KB-Kamera, die noch zum völlig irrationalen, aber üblichen Leica-Preis neu angeboten wird (auch erhältlich als Titan-Version für 20000 $). Ähnlich exotisch ist es auch bei Mittelformat mit immerhin noch 2 Modellen: Alpa 12+ und Rolleiflex Hy6. Für keinen der anderen Kamerahersteller stellt derzeit ein neues Film-Kameramodell ein tragfähiges Geschäftsmodell dar. Randerscheinungen sind z.B. Lomo-Plastikkameras und Fuji mit seinen Instax-Kameras. Die letzteren verdienen ihr Geld aber nicht mit den einfachen Kameras, sondern mit den Sofortbild-Packs. Ach ja, fast hätte ich’s vergessen: unter diversen Markennamen gibt es, falls überhaupt lieferbar, noch ukrainische 6×6-Kameras und Objektive von Kiev/Arax/Arsat/Hartblei. Aber will man so etwas haben? (Siehe die Anmerkungen zu meinen →Mittelformat-Kameras)
Ob aus bloßen Ankündigungen von Ricoh/Pentax oder MiNT/Rollei irgendwann tatsächlich neue und vor allem erschwingliche „Film“-Kameras entstehen werden, bleibt noch abzuwarten. Ich empfehle, in der alternden Verwandtschaft herumzufragen, ob jemand noch ein Spiegelreflex-Schätzchen auf dem Dachboden hat und ob man es sich mal ausleihen dürfte. Normalerweise bekommt man das dann geschenkt. Hochwertige, gebrauchte und noch lange Zeit funktionierende Kameras sind immer noch reichlich vorhanden. Man muss lediglich Geduld mitbringen, den Markt (d.h. ebay-Auktionen, wegen hohen Betrugsrisikos NICHT die Kleinanzeigen!) erst mal eine Weile beobachten, vergleichen und bei dubiosen Privatverkäufen vorsichtig sein. Mein Eindruck ist, dass sich dort nicht ausschließlich, aber zunehmend Schrott konzentriert, der immer wieder weiterverkauft wird. Zielführend ist eventuell auch, die Wunschausrüstung mehrfach billigst bei privaten Anbietern zu kaufen und zu hoffen, dass mit Glück ein perfektes Exemplar dabei ist. Bei der Olympus XA hat sich diese Methode für mich leider als Flop erwiesen. Ich empfehle daher, sich eher an den jüngeren Analogmodellen der jeweiligen Hersteller zu orientieren.
Da die letzten Analog-Modelle und die digitalen SLRs den gleichen Objektivanschluss haben, sind die richtig guten Autofokus-Objektive auch gebraucht noch recht teuer. Günstiger waren bis etwa 2020 die alten Anschlüsse für manuelle Fokussierung, z.B. Canon FD, Minolta MC/MD, Olympus OM. Wenn man bereits gute M42-Objektive hat (wie z.B. die Pentax SMC-Takumare), lohnt sich neben der überteuerten Pentax Spotmatik auch ein Blick auf die Praktica L-Reihe. Nikon und Pentax-K waren bei der Umstellung auf Autofokus aufwärtskompatibel, und deren alte Linsen waren auch ohne Autofocus immer begehrt. Seit Anfang der 20er scheint sich das Preisniveau umzukehren: Autofokus-SLRs werden als Massenware billiger, noch funktionsfähige alte SLRs mit manueller Fokussierung werden seltener und teurer. Im Zweifelsfall und als Analog-Anfänger kann man natürlich auch in der nächsten größeren Stadt in der Altmetall-Abteilung eines richtigen Fotogeschäfts danach fragen, falls es dort noch so etwas gibt.
Defekte Kameras oder Objektive bedeuten mangels Ersatzteilen und erfahrenen Kameraschraubern oft einen wirtschaftlichen Totalschaden. Unter Analog-Fotografen ist daher der Trend zur Zweit- oder Drittkamera einschließlich üppiger Objektivauswahl weit verbreitet. Daraus kann dann, wenn man sich nicht beherrscht, schnell eine Sammelleidenschaft werden - ich habe Sie hiermit gewarnt! Für den Einstieg braucht man gar nicht viel, auf keinen Fall eine Sammlervitrine, sondern besser nur 1 Kamera und 1 Objektiv, deren Handhabung man aber intuitiv beherrschen sollte, siehe →Regeln Nr. 5 und 6. Welcher Markenname draufsteht, ist egal. Tipps, wonach Sie suchen könnten, finden Sie möglicherweise bei der Auflistung meiner eigenen →Ausrüstung. Wenn dabei Preise genannt werden, sind das immer die Preise, die ich gezahlt habe. Das spiegelt sicher nicht mehr den aktuellen Stand wieder. Generell gilt: Gute Objektive und gut erhaltene, uneingeschränkt funktionierende Gehäuse steigen kontinuierlich im Wert.
Filme und Laborbedarf: Deutlich einfacher als bei Kameras ist die Kostenprognose bei den Verbrauchsmaterialien. Für diesen Vergleich habe ich aus einem alten Katalog meines Lieblings-Fotolaborversands einige Artikel ausgewählt, die es auch 2022 noch gab. Weil sich die Mehrwertsteuer geändert hat, darf man natürlich nur Nettopreise vergleichen. Alte DM-Preise von 1995, dem Höhepunkt der Filmtechnologie, sind hier bereits in EUR aufgeführt und werden mit der amtlichen Inflationsrate auf Ende 2022 hochgerechnet.
- 36er Kleinbildfilm Ilford FP4+ oder HP5+ im 10er-Pack:
1995: 2,98€ (→ 4,91€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 7,12€ (+45%)
(Achtung: Es gibt auch Händler, die frech das Doppelte dafür verlangen!) - Ilford Multigrade RC, 100 Blatt 18×24:
1995: 37,88€ (→ 62,38€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 63,78€ (+2%) - Filmentwickler Kodak HC110, 1 Ltr.:
1995: 19,96€ (→ 32,87€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 33,50€ (+2%) - SW-Schnellfixierer (Hausmarke), 1 Ltr.:
1995: 5,29€ (→ 8,71€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 11,72€ (+35%) - Farbnegativfilm Kodak Gold 200:
1995: 3,50€; Anfang 2021 im Drogeriemarkt: 2,23€ (inflationsbereinigt -55%). Bei diesem Kampfpreis waren die Filme natürlich ruckzuck ausverkauft und nicht mehr lieferbar. Dann war dieser Film zwischendurch so teuer, dass ihn niemand haben wollte. Ende 2021 lag der Preis bei 3,63€ (immer noch -27%), dann schon wieder nicht lieferbar - ein kontinuierliches auf und ab. Ende 2022 sind schließlich alle Farbfilme teure Mangelware.
Die Preisentwicklung ist nicht einheitlich und war für einen Nischenmarkt bis 2020 äußerst entspannt. Seitdem sind die Preise auch inflationsbereinigt leider weiter gestiegen, weil die zunehmende Nachfrage das erlaubt. Vor allem Fuji und Kodak versuchen seit längerem, mit extremen Preissteigerungen diesen Boom für sich zu nutzen. Ob sie Erfolg damit haben, werden die Regeln von Angebot und Nachfrage zeigen. Bisher konnte man für etliche Produkte immer noch auf günstigere Konkurrenzangebote ausweichen. Weitere solche Preisvergleiche habe ich vermieden, ich will mir nicht die Lust am Hobby verderben. Zumindest für Ende 2022 war widerlegt, dass dieses Hobby teuer ist, solange man nicht unsinnig viel Geld für eine Kamera- und Objektivsammlung ausgegeben hat. Exklusiv ist analoge Fotografie aber schon :-)
Haben Sie im Vergleich dazu schon mal zusammenaddiert, wie viele EUR Sie als Hobby-Fotograf in den letzten 25 Jahren für Digi-Knipsen, Speicherkarten, Software samt Anleitungsbüchern, schnelle PCs, externe Festplatten, kalibrierbare Monitore, Scanner und Farbdrucker, Spezialtinten und -papier, Cloud-Speicher usw. ausgegeben haben? Bitte rechnen Sie auch alles mit ein, was bisher mit dem Elektronik-Schrott auf irgendeiner Deponie in Afrika gelandet ist!
Fragen zu Film und Negativ
Welcher Entwickler ist der beste?
Diese Frage ist sicher nicht die wichtigste. Sie steht in meiner Liste deshalb weit oben, weil sie mit schöner Regelmäßigkeit in allen Fotolaborforen gestellt wird. In den zahlreichen Antworten werden dann ebenso regelmäßig alle(!) marktgängigen Entwickler aufgezählt und mit religiösem Eifer in höchsten Tönen gepriesen. Man kann das wohl so interpretieren, dass es eine für alle Fotografen gleichermaßen optimale Kombination nicht gibt. Den Herstellerangaben kann man sowieso nicht trauen, denn dort sind fast alle Entwickler für alles optimal geeignet.
Vor der Auswahl kommt erst die Entscheidung, was man aus dem Film herausholen will:
a) möglichst hohe Ausnutzung der Filmempfindlichkeit,
b) möglichst feines Korn oder
c) möglichst hohe Schärfe.
Es gibt Spezialentwickler für jedes dieser Ziele. Einige Entwickler schaffen es sogar, Feinkorn und Schärfe gleichzeitig zu optimieren. Aber auch wenn die Hersteller noch so tolle Versprechungen machen: Alle drei Optimierungsziele sind niemals gemeinsam erreichbar. Typische Vertreter der genannten 3 Gruppen sind z.B.:
a) hohe Empfindlichkeit: Adox Atomal 49, Ilford Microphen
Wenn man niedrigen Negativkontrast für alte →Kondensor-Vergrößerer anstrebt,
ist die Nennempfindlichkeit auch mit solchen Entwicklern nicht erreichbar.
b) feines Korn: Spur HRX, Ilford Perceptol, Moersch efd (für Feinkorn-Fans: sehr viel wirksamer als solche Spezialentwickler wäre ein niedrigempfindlicher Film!)
c) hohe Schärfe: Spur SD2525, CG-512 (=Rollei RLS), Jobo alpha, Moersch efd
Viele andere Entwickler haben gar keine hervorstechenden Eigenschaften und führen zu einem Kompromiss zwischen den drei genannten Zielen, so wie es bei einem Universalentwickler eben sein soll (wie z.B. ID11, D-76 oder der modernere Xtol bzw. Adox XT-3). Bei manchen Hobbylaboranten kommen als primäre Ziele dann noch Haltbarkeit, einfache Handhabung, Kosten pro Film oder →gesundheitliche Bedenken dazu. Ein reichhaltiges Angebot an Filmentwicklern sorgt für eine Erfüllung aller Wünsche, solange man nicht a)+b)+c) gleichzeitig haben will. Bitte kommen Sie jetzt bloß nicht auf die Idee, alles auszuprobieren, was angeboten wird!
Durch die Verdünnung des Entwicklers können die Ergebnisse zusätzlich beeinflusst werden.
Diese Regel gilt vor allem für Pulverentwickler mit einem hohen Gehalt an Natriumsulfit, sogenannte Pseudo-Feinkornentwickler.
Natriumsulfit verhindert als Konservierungsmittel primär die allzu schnelle Oxidation des Entwicklers,
löst aber auch Entwicklungskeime an den Silberhalogenid-Körnern an und verhindert Kornwachstum.
Die danach in Lösung befindlichen Silber-Ionen werden dann zum Teil wieder an vorhandene Silberkeime angelagert.
In alter Literatur wurde das fälschlicherweise als „physikalische“ Entwicklung bezeichnet,
natürlich ist auch das eine chemische Redox-Reaktion. Das Ganze bewirkt Feinkörnigkeit,
allerdings auf Kosten der Kantenschärfe. Manche behaupten, solche Bilder seien matschig.
Da die Anlösung die Schwärzung etwas reduziert, geht das auch noch zulasten der Filmempfindlichkeit.
Dieser Effekt ist - sofern man ihn überhaupt feststellt - am deutlichsten ausgeprägt,
wenn man solche Entwickler als Stammlösung verwendet, wovon ich abrate, weil Feinkorn zumindest bei mir nicht das primäre Ziel ist.
Ein gerade erkennbares Korn kann den visuellen Schärfeeindruck sogar steigern.
Meine Empfehlung wäre, solche Entwickler in Verdünnung 1+1 als Einmal-Entwickler zu verwenden.
Die Verdünnung schwächt die Wirkung von Natriumsulfit, das Filmkorn wird geringfügig(!) gröber
und die Schärfe und die Filmempfindlichkeit nehmen geringfügig(!) zu.
Bei Verdünnungen ist stets auch die Herstellerempfehlung für eine Mindestmenge an Stammlösung je Film zu beachten.
Bei Xtol sind das z.B. 100 ml. Bei D-76 gelten die Zeiten des Datenblatts für 240 ml (8 ounces) Stammlösung je Film;
mit 120 ml Stammlösung muss die Entwicklungszeit für 1 Film bereits um 10% verlängert werden.
Mit Verdünnungen bis 1+3 kann die Wirkung des Natriumsulfits weiter reduziert und die Schärfe möglicherweise
noch weiter gesteigert werden. Zur Gruppe dieser Entwickler zählen z.B. D-76, ID11, Xtol, XT-3 und A49.
Rodinal dagegen funktioniert völlig anders und ergibt bei höherer Verdünnung weniger grobes Korn.
Dazu gleich mein persönlicher Kommentar zu Rodinal/Paranol/R09/Adonal, auch wenn viele treue Anhänger jetzt die Augen verdrehen: Dieser Entwickler verträgt sich leider nicht mit allen Filmen (z.B. überhaupt nicht mit FP4) und kann einen durchhängenden Dichteverlauf mit stark ausgefressenen Lichtern erzeugen. Er ist also genau das Gegenteil eines →Ausgleichsentwicklers. Daher ist dieser Entwickler nicht gerade eine Empfehlung für Anfänger. Nach tatsächlichen eigenen Erfahrungen wird damit das Korn auf jeden Fall ziemlich grob und die Empfindlichkeit wird schlecht ausgenutzt, lediglich bei der Schärfe erreicht man Mittelmaß. Das reicht schon aus, dass Rodinal von seinen Anhängern als „Schärfe-Entwickler mit schön akzentuiertem Korn“ gerühmt wird. Es gibt Spezialisten, die durch Entwicklung bei max. 16°C auch mit Rodinal das Korn zurückhalten, aber auf solche Temperaturfummeleien habe ich(!) wenig Lust. Ich entwickle Filme auch im Sommer, da ist die Einhaltung von 20° schon sportlich! Original Agfa Rodinal gibt es übrigens seit 2005 nicht mehr. Die zahlreichen Nachbauten unterscheiden sich vor allem in der Haltbarkeit. Um diese Haltbarkeit spinnen sich zahlreiche Legenden, die man nicht alle glauben darf!
Neue Beliebtheit erfahren gerade auch wieder Monobad-Entwickler wie CineStill Df96. Für Neu-Einsteiger wird eine einfachste Handhabung versprochen, doch glauben Sie bitte nicht alles, was Werbung verspricht. Bei diesem Prozess wird eine abgestimmte Mischung aus schnell arbeitender Entwicklersubstanz und Fixierer gleichzeitig in die Dose gekippt. Der Entwicklungsprozess muss abgeschlossen sein, bevor der langsamer arbeitende Fixierer alle Silberhalogenidkörner aufgelöst hat. Dieser Prozess ist heutzutage völlig überflüssig und alles andere als fehlertolerant. Eine Änderung der Entwicklungszeit zum Erreichen eines bestimmten Kontrasts (→gamma-Wert) funktioniert damit natürlich auch nicht. Stattdessen müsste man gezielt die Temperatur ändern. Ich werde mich hüten, sowas überhaupt anzurühren! Solche Monobad-Entwickler sind keineswegs etwas Neues. Ursprünglich waren sie bei Fotojournalisten beliebt, die mit ihren Kameras ins Redaktionsgebäude liefen und wenige Minuten danach bereits brandaktuelle Bilder beim Chefredakteur vorzeigen mussten. Für 20 Minuten lange Entwicklungs-Prozeduren hatten die keine Zeit, und die Qualität war bei dem groben Zeitungsraster weitgehend egal. Ansonsten war die Kombination TriX oder HP5 in HC-110 wegen der kurzen Entwicklungszeiten jahrzehntelang der Liebling der Fotoreporter.
Dann gibt es noch eine weitere Gruppe: sogenannte Ausgleichsentwickler, die bei hohen Kontrasten ausgleichend wirken und die Spitzlichter etwas abschwächen, z.B. Moersch MZB, Adox FX-39 II (1+19) oder Amaloco AM74 (Vertrieb über Nordfoto). Was zunächst als Vorteil erscheint, hat jedoch einen geringeren Belichtungsspielraum zur Folge. Schon bei mäßigen Überbelichtungen liegen die wichtigen Mitteltöne im kontrastarmen oberen Teil der →Dichtekurve. Genau die entgegengesetzte Tendenz mit steiler werdendem Kurvenverlauf und dem Risiko ausgebrannter Lichter zeigen Rodinal und HC-110 (≈Ilfotec HC).
Besonders Experimentierfreudige können Ihren Filmentwickler natürlich auch aus Rohchemikalien selbst anmischen. Im Trend liegen hier das übel riechende Caffenol, dessen Zutaten einfach zu besorgen sind, oder ein Pyro-Entwickler (Achtung: giftig!). Ich selbst würde hier eher zu einem gut haltbaren und nasen- und umweltfreundlicheren FX-55 tendieren, ein im Ergebnis mit Xtol vergleichbarer Ansatz von Geoffrey Crawley (Youtube-Video dazu unter Pictorial Planet). Mangels eigener Erfahrungen möchte ich dieses Thema hier nicht weiter ausführen.
Für Fotografen mit größerem Filmdurchsatz (und nur für solche) gibt es noch die Möglichkeit, Xtol unverdünnt zu verwenden und die Arbeitslösung zu regenerieren. Auch das Xtol-Datenblatt enthält ein Kapitel dazu. Kaum ein anderer Entwickler ist dermaßen vielseitig und universell in seiner Anwendung. Viele SW-Fans im amerikanischen photrio-Forum schwärmen vor allem von der Negativqualität mit diesem Xtol-R (“replenished”). Selbst habe ich das noch nicht versucht, daher zitiere ich mehr oder weniger:
- Aus dem 5-Liter-Ansatz werden z.B. 2 Liter Stammlösung in eine eigene Flasche gefüllt und die Filme stets mit dieser unverdünnten Xtol-Arbeitslösung entwickelt. Bis diese anfänglich frischen 2 Liter einen stabilen Regenerations-Zustand erreicht haben, muss man die Entwicklungszeit schrittweise erhöhen. Die Entwicklungszeit für Xtol-R beträgt lt. Datenblatt das 1,22-fache der Zeitempfehlung für unverdünnte, frische Stammlösung.
- Kodak empfiehlt, dass man je entwickeltem Film 70±10 ml Regenerator (= Xtol-Stammlösung) aus dem Vorrat in die Arbeitslösungsflasche gibt, während der Film in der Dose entwickelt wird. Nach Beendigung der Entwicklung wird der zuletzt verwendete Entwickler zurück in die Flasche mit der Arbeitslösung gegossen. Wenn man den gesamten Entwickler in die Flasche zurück gießt, würde sie überlaufen; der Überschuss kommt in den Gully. Das Regenerator-Volumen kann man z.B. auf 80 ml erhöhen, wenn die an der Schattenzeichnung erkennbare Aktivität mit der Zeit nachlässt. Kodak empfiehlt, die niedrigste Nachfüllrate zu verwenden, bei der der Prozess noch unter Kontrolle ist.
- Theoretisch kann das ewig so weitergehen. Sinnvoll ist das jedoch nur, wenn ein minimaler Umsatz von 2 bis 3 Filmen je Woche vorliegt.
Meine obige Gruppeneinteilung der Entwickler mag der Eine oder Andere anzweifeln. Die Grenzen sind schwimmend und ich werde mich hüten, alle genannten Entwickler selbst auszutesten. Was Sie hier lesen, ist teilweise also eine Zusammenfassung dessen, „was man so hört“ und was die Fachliteratur dazu sagt. Erschwerend kommt noch dazu, dass bei Weitem nicht alle chemischen Abläufe bei der Entwicklung wissenschaftlich erklärbar sind, wie etwa die Wechselwirkungen mit der Gelatine, in die die lichtempfindlichen Kristalle eingebettet sind. Es kann daher auch keinen veganen Film geben! Das Ganze hat immer noch so einen Hauch von mittelalterlicher Alchemie.
Tatsache ist, dass entgegen allen Werbeaussagen die Eigenschaften eines Negatives in Sachen Feinkorn und Schärfe überwiegend durch den Film selbst definiert werden. Der Einfluss des Entwicklers auf diese beiden Kenngrößen wird oft arg überschätzt. Um die Unterschiede im Ergebnis erkennen zu können, muss man Vergleichsaufnahmen mit geschultem Auge und genau ansehen. Wenn man jetzt nicht gerade Rodinal mit A49 vergleicht, kommt das meiste, was man an Unterschieden zu erkennen glaubt, aus dem Bereich der Esoterik. Was bleibt, ist vor allem die unterschiedliche Ausnutzung der Filmempfindlichkeit.
Meine Empfehlung lautet für Anfänger und Wiedereinsteiger (Könner machen das ohnehin):
Am besten fährt man zunächst mit einem überall erhältlichen und bewährten Universalentwickler, der sich mit allen Filmen bestens verträgt.
Xtol oder Adox XT-3 als 1+1 Einmalentwickler ist klar mein(!) Favorit, weil er wenig kostet, sich mit allen modernen Filmen verträgt,
in jeder Hinsicht ein etwas besseres Ergebnis bringt als Kodak D-76 oder Ilford ID11 und
letztendlich (weil Hydrochinon-frei)
weniger ungesund ist. Meine persönliche Meinung, anders ausgedrückt:
Es gibt heute, außer weil man’s immer schon gemacht hat, keinen Grund mehr,
D-76 oder ID11 anzurühren. Damit die angesetzten Stammlösungen solcher Pulverentwickler auch
noch lange halten, finden Sie hier Tipps zum →Ansatz von Pulverentwicklern.
Man liest überall von der geringen →Haltbarkeit von Xtol, doch das ist eindeutig ein Gerücht!
Wer lieber Flüssigkonzentrate verwendet, sollte als Universalentwickler folgende ausprobieren:
Adox FX-39 II (= verbesserte Variante des alten Neofin rot) oder HC-110
(≈ Ilfotec-HC oder für kleineren Durchsatz Ilfotec-LC).
Diese sind beide nicht gerade Feinkorn-Spezialisten, und bringen tendenziell gegensätzliche Ergebnisse:
FX-39 leicht ausgleichend, HC-110 leicht aufsteilend.
Mit dem neuen, gut haltbaren „efd“ Eco Film Developer scheint Wolfgang Moersch
der Spagat zwischen feinem Korn und hoher Schärfe bestmöglich gelungen zu sein.
Dieser Entwickler funktioniert leider nicht mehr so gut bei hochempfindlichen Filmen.
Unter Kennern nicht unbekannt als gut haltbares und scharf arbeitendes Flüssig-Konzentrat
ist der SW-Entwickler von Klaus Wehner, jetzt als „JOBO alpha“ endlich offiziell im Vertrieb.
Offensichtlich hat man bei Entwicklern eine überwältigende Auswahl. Trotzdem empfehle ich für Anfänger die Einschränkung z.B. auf 2 Markenfilme (100er im Sommer, 400er in der dunklen Jahreszeit) und nur 1 (in Worten: einen) Universal-Entwickler. Entwickelt wird immer unter konstanter Einhaltung von Verdünnungsgrad, →Temperatur und →Kipprhythmus. Damit muss man zunächst seine eigenen Prozesse optimieren. Erst wenn man das nach einigen -zig Filmen geschafft hat und weiß, was man anstrebt, kann ein gezielter Wechsel des Entwicklers vielleicht eine kleine(!) Veränderung bringen.
Wovor ich warnen möchte: Wenn man die Diskussionen in den Fotolabor-Foren einige Jahre mitverfolgt hat, kann man vor allem bei den Filmentwicklern deutlich auszumachende Modetrends feststellen. Trendsetter waren im Laufe der letzten Jahre A49, HRX oder Diafine. Mein Appell lautet, nicht schwach zu werden und auf der ewigen Suche nach dem Wunderentwickler in langwierigen Vergleichstests alles durchzuprobieren. Die besten Ergebnisse wird man immer noch mit dem Entwickler zustande bringen, mit dem man langfristig die meisten eigenen Erfahrungen gesammelt hat. Der beste Beweis für diese zum Erfolg führende Einstellung: Die Opas unter den SW-Fotografen schwören seit jeher auf die alten Bestseller D-76 (seit 1927) oder Rodinal (seit 1891), je nachdem ob sie Kodak- oder Agfa-Anhänger waren. Sie sind durch nichts von dieser Meinung abzubringen, was auch seine Berechtigung hat. Alles was Sie hier über SW-Entwickler lesen, gilt also eher für Anfänger und Wiedereinsteiger, die auf diesen Seiten hoffentlich sinnvolle und auch aktuelle Ratschläge finden.
Zur Info für Xtol-Fans: Für meine Xtol-Empfehlung war seit Anfang 2021 Zurückhaltung
angebracht. Eastman Kodak stellt wohl seit 1994 (Abspaltung von Eastman Chemicals) keine SW-Chemie mehr selbst her
und hat deren Vertrieb nach der Insolvenz 2013 unter der Marke “Kodak Alaris” an einen britischen Pensionsfonds ausgegliedert.
Hergestellt wurde jahrelang in Deutschland bis zur ersten Insolvenz von Tetenal 2019.
Daraufhin wurde die Produktion wohl irgendwohin in die USA verlegt. Dann kam die Corona-Pandemie.
Dann hat Kodak das gesamte SW-Chemie-Geschäft an Sino Promise (Hongkong) abgetreten.
Dann kamen die Probleme der weltweiten Lieferketten.
Wie und ob es nach mehreren miserabel kommunizierten Rückrufaktionen dauerhaft weiter gehen würde, wusste lange keiner.
Man konnte zwar eine eMail hinschicken, aber Reaktion kam keine. Ich warte vergeblich auf eine versprochene Xtol-Ersatzlieferung.
Probleme mit verfärbten Pulveransätzen, die schlecht oder gar nicht entwickelt haben, gab es auch bei Dektol und D-76.
Sogar die Kodak-Fans im amerikanischen photrio-Forum
fühlten sich vom „Gelben Riesen“, der nur noch ein Torso ist, angepisst.
Glücklicherweise gibt es für alles weitgehend identische, wenn nicht bessere Konkurrenzprodukte:
Adox XT-3 statt Xtol,
Ilfotec-HC statt des neu-formulierten HC-110 (lt. Troop/Anchell Film Developing Cookbook
seit 2019 mit verschlechterter Haltbarkeit),
ID11 oder Adox-D76 statt D-76, irgendein Papierentwickler statt Dektol, und auch Fixierer ist durch beliebige Marken ersetzbar.
Anfang 2022 hat sich die Liefersituation kurzfristig beruhigt und die Kodak SW-Chemie war wieder vertrauenswürdig.
Auf den Xtol-Tüten stand jetzt "Made in Germany for Sino Promise", d.h. Tetenal hat die alten Geschäfte wieder aufgenommen.
Stand April '23: Tetenal ist wieder insolvent, auch wenn deren Website das verschweigt.
Chemie der Marke Tetenal gibt es also nicht mehr, was vor allem Diafilm-Freunde vermissen werden.
Der bisherige Hersteller der SW-Chemie von Ilford und Kodak fällt damit ebenfalls aus.
Kodak Alaris steht zum Verkauf und Sino-Promise hat den Verkauf sämtlicher Kodak Fotochemikalien eingestellt.
(Quelle: Mirko/Adox).
Trauriges Fazit: Fotochemie von Kodak gibt es vorübergehend (oder endgültig?) nicht mehr.
Filme der Marke Kodak werden dagegen unverändert von Eastman Kodak in USA hergestellt.
Welcher Schwarzweißfilm ist der beste?
Ich empfehle Ilford, weil es diese Filme seit Jahrzehnten in anerkannt hoher Qualität zu kaufen gibt. Der Qualitätsstandard dieser traditionsreichen Marke ist über alle Zweifel erhaben, und die Filme haben keine Zickigkeiten, die einen Anfänger verwirren könnten. Alle diese Vorzüge gelten auch für SW-Filme von Kodak oder Fuji, die leider extrem teuer geworden sind. Mein Preis-Leistungs-Tipp wäre Kentmere als Billigmarke aus dem Hause Harman/Ilford. Kentmere-Filme erfüllen mit nur leichten Abstrichen beim Lichthofschutz alle Anforderungen an einen modernen Schwarzweißfilm.
Dann gibt es noch die tschechischen Foma-Filme. Diese erreichen grundsätzlich nicht die angegebene Nennempfindlichkeit, sind grobkörniger und die Gelatineschicht ist weniger gehärtet, also empfindlicher gegen Kratzer. Wegen zunehmend schlechter (oder gar keiner?) Qualitätskontrolle muss man mit diversen Mängeln rechnen (Kratzer, Fehler in der Emulsion, ...), so dass derzeit davon abzuraten ist.
Noch zwei möglicherweise gute Nachrichten:
1. Shanghai hat mit ORWO-Unterstützung oder möglicherweise sogar original Filmotec Emulsion die Produktion des GP3 wieder aufgenommen.
Dort kann man sogar 220-er Rollfilme
oder 127-er für die Baby-Rollei bestellen! Bis diese Filme bei uns erhältlich sein werden, kann es noch dauern,
und es ist abzuwarten, ob sie die hier gewohnten Qualitätsstandards erfüllen können.
Leider hat man nicht nur bei Foma, sondern auch bei 120-er Shanghai wiederholt von Qualitätsproblemen gehört,
womit aber in Einzelfällen auch schon Eastman Kodak (im Negativ sichtbare Nummerierung des Rückpapiers), Ilford
und Bergger (Fleckenmuster, Marmorierung auf dem Negativ) zu kämpfen hatten.
Probleme macht wohl nicht der Film selbst, sondern das Rückpapier und die Konfektionierung.
Früher, als alles noch besser war 😃, haben die Filmhersteller die Lieferanten ihres
Rückpapiers eben sorgfältig ausgewählt und überwacht.
Heute ist das nur noch ein Nischenprodukt und vieles muss einfach irgendwo zugekauft werden.
2. Auch Ferrania in Italien scheint zumindest wieder mit der kontinuierlichen Herstellung von SW-Filmen angefangen zu haben.
Der P30 (nominell 80 ISO) als Neuauflage eines Uraltfilms ist scharf und feinkörnig, erscheint mir(!) jedoch wenig interessant.
Es gibt aber bereits einen P33 mit 160 ISO, und ein P36 mit 320 ISO ist angekündigt.
Vom ursprünglich angekündigten Farbdiafilm hört man dagegen gar nichts mehr.
In den Jahren nach der Agfa-Pleite waren die original APX-Restbestände (mit der roten Raute auf der Schachtel) ein qualitativ hochwertiges Schnäppchen. Mittlerweile werden unter der Marke Agfaphoto mit rotem Punkt als Markenlogo Filme verhökert, die mit Agfa überhaupt nichts zu tun haben. Achtung: Was man früher unter dem Namen Agfa kaufen konnte, ist seit 2005 definitiv Geschichte. AgfaPhoto ist genauso wie Lomography oder Rollei lediglich eine Handelsmarke ohne eigene Filmfertigung. Was unter diesen Namen umgelabelt und verkauft wird, kann sich ständig ändern. Ein offenes Geheimnis: Derzeit ist in den APX-Schachteln englischer Kentmere-Film drin. Da gibt’s also gerade nichts zu meckern.
Leider verlockt der derzeitige Analog-Boom etliche Firmen dazu, altbekannte Filme unter wohlklingenden Markennamen und in Verpackungen mit nettem Design zu einem Vielfachen des Preises anzubieten, den man für einen deutlich besseren, frisch hergestellten Markenfilm bezahlen müsste. Vorsicht, fallen Sie bitte nicht auf jeden billigen Werbe-Trick herein: Genauso wie es keinen Wunderentwickler gibt, gibt es erst recht keinen Wunderfilm. Manchmal steckt ganz normaler billiger Foma-Film drin (oder einer von noch weiter östlich). Oft wird auch Industrieware, die sonst nicht im Einzelhandel erhältlich ist, irgendwo im Auftrag konfektioniert, wie z.B. niedrigempfindliche Dokumentenfilme, infrarotempfindliche Überwachungsfilme oder kontrastreich abbildende Luftbildfilme. Diese Filme, meist aus dem für gewerbliche Großkunden noch(?) produzierenden Agfa-Gevaert-Werk in Belgien, sind natürlich in ihren Eigenschaften für einen sehr speziellen Anwendungszweck optimiert und daher für allgemeine Fotografie nur eingeschränkt verwendbar. Das gilt auch für die orthochromatischen (d.h. rot-unempfindlichen) Filme, die man als Planfilm bei Rotlicht in der Schale entwickeln kann. Solche Spezialitäten sind nur etwas für Experimentierfreudige. Bessere Bilder macht man damit sicher nicht. Für Anfänger und Gelegenheitsknipser ist eine Einarbeitung auf solch eine Filmsorte auf keinen Fall sinnvoll. Da für diese Kleinserien teilweise auch in Handarbeit konfektioniert wird, kann es Qualitätsprobleme geben, was in Internet-Foren immer wieder kritisiert wird (z.B. falsche DX-Codierung bei Kleinbildpatronen, ungleichmäßig angeklebter Filmanfang oder fehlende Klebelaschen bei Rollfilmen). Das Ganze belegt aber sehr positiv, dass der Schwarzweiß-Markt äußerst lebendig ist und auch heute noch eine große Vielfalt an technischen Möglichkeiten bietet.
Konventionelle Filme oder Flachkristallfilme?
Bei der Schwarzweißfilmtechnologie wird unterschieden zwischen konventionellen Filmen mit kubischen Kristallen und (schon seit 1986) Filmen in „neuer“ Technologie mit Flachkristallen. Zu den letzteren gehören eindeutig Kodak Tmax und Ilford Delta. Bei Fomapan 200 und Fuji Acros ist eine solche Zuordnung nicht eindeutig. Ob man „alt“ oder „neu“ wählt, ist Geschmackssache. Neu heißt hier nicht unbedingt besser. Die Filmhersteller haben diese Flachkristall-Technologie vor allem entwickelt, um den Silbergehalt und damit die Kosten für die Massenproduktion an Farbfilmen zu minimieren. Weil das dort gut funktioniert hat, wurde diese Technologie dann auch auf einige SW-Filme übertragen. Generell gilt, dass die Flachkristallfilme etwas feinkörniger sind, dafür aber im Ruf stehen, exakter belichtet und verarbeitet werden zu müssen. Dieses Gerücht schreibt seit Jahrzehnten Einer vom Anderen ab, aber dadurch wird es leider nicht wahrer. Bei mir sind die Filme alle noch was geworden. Es gibt keinen Grund, bei konventionellen Filmen weniger exakt zu arbeiten. Zu beachten ist lediglich, dass Flachkristallfilme →länger fixiert werden müssen, und dass dabei das Fixierbad auch noch schneller erschöpft ist. Dafür wird man belohnt mit feinem Korn und einer langen geraden Kennlinie, die sehr tolerant gegenüber Überbelichtung ist und daher eben die Spitzlichter nicht automatisch ausgleicht. Weil man bei üblichen Abzügen noch überhaupt kein Korn erkennen kann, wird den Flachkristallfilmen oft ein technischer Look vorgeworfen, d.h. die Bilder sehen aus wie Digitalbilder, bei denen man die Farbsättigung herausgenommen hat. Die Anhänger der „alten“ Technologie heben immer hervor, dass ihnen dort die Grauwertumsetzung besser zusagt, was ich nicht nachvollziehen kann. Eine gerade erkennbare Körnigkeit ist dagegen ein gewolltes Gestaltungsmittel, das mit den konventionellen Filmen besser gelingt.
„Unechte“ SW-Filme
Neben den echten Schwarzweißfilmen gibt es auch noch einen Film, der für den standardisierten C41-Farbnegativprozess vorgesehen ist: Ilford XP2 Super mit einer Nennempfindlichkeit von 400 ISO. Beim C41-Entwicklungsprozess wird das ursprünglich vorhandene Silberkorn vollständig entfernt und durch Farbstoffwölkchen ersetzt. Die XP2-Negative sehen aus wie gewöhnliche SW-Negative, d.h. farbneutral ohne die bei Farbnegativen übliche Orangemaske. Den XP2 kann man problemlos im nächsten Minilab oder Drogeriemarkt entwickeln lassen, Vergrößerungen macht man dagegen besser zu Hause auf gewöhnliches SW-Papier. Die Vorteile dieses „unechten“ Schwarzweißfilms sind die gute Eignung zum Scannen mit automatischer Staubentfernung und der C41-typische sehr große Belichtungsspielraum. Selbst wenn man die Belichtung immer nur schätzt, kann man kaum etwas falsch machen. Dieser Schwarzweißfilm ist auch eine Top-Empfehlung für alle, die keine Lust haben, ihre Filme selbst zu entwickeln. Da aber die Filmentwicklung und die Steuerbarkeit dieses Prozesses ein wichtiger Teil meines Fotolabor-Hobbys ist, ist meine persönliche Meinung: Nur für Sonderzwecke, wenn’s mal sein muss!
Eine Verarbeitung des XP2 in normaler SW-Chemie ist im Prinzip möglich, bringt aber schlechtere Ergebnisse und hat nicht die typischen Vorzüge des C41-Prozesses.
Der Konkurrenzfilm von Kodak hieß BW400CN und wurde bis August 2014 hergestellt. Zu exotischen Preisen werden immer noch gelegentlich Restexemplare angeboten. (Noch früher gab es solche Filme auch von Agfa, Fuji und Konica.) Der BW400CN wies die von Farbnegativfilmen gewohnte Orangefärbung auf und wurde idealerweise im Großlabor auf Colorpapier vergrößert. Für bessere Qualität war die bevorzugte Arbeitsweise mit diesem Film die hybride Verarbeitung, d.h. einscannen und digital weiterverarbeiten. Da konnte man natürlich auch gleich einen deutlich billigeren Standard-Farbnegativfilm nehmen und digital die Farbsättigung herausnehmen. Daher habe ich diesen Film schon immer für überflüssig gehalten.
Meine Empfehlungen für Anfänger
Nischenprodukte und die von Umverpackern möchte ich hier bewusst ausschließen. Ich beschränke mich in meinen Empfehlungen auf traditionelle Markenhersteller, deren Filme weitgehend konstant im einschlägigen →Versandhandel verfügbar sind. Für 135er Kleinbildfilm bleiben noch reichlich Empfehlungen in der engeren Auswahl. Bei 120er Rollfilm oder gar Großformat wird die Auswahl etwas kleiner. Für alle genannten Filme gilt außerdem, dass die aufgedruckte Nennempfindlichkeit nur mit Entwicklern erreicht wird, die die Empfindlichkeit gut ausnutzen, und auch nur dann, wenn man die Filme auf einen hohen Kontrast für reine Mischbox-Vergrößerer entwickelt. Es gilt also mein immer wieder genannter Tipp, bei unbekannten Film-Entwickler-Kombinationen mit einer Blende Überbelichtung zu beginnen und sich von dieser Seite her an das Optimum heranzutasten.
- unter 100 ISO: Ilford PanF Plus
Dieser Film der 25-50 ISO-Klasse ist fast ein „normaler“, klassischer SW-Film mit feinem Korn, aber nicht unbedingt schärfer. Für optimale Schärfe empfehle ich Delta 100 oder Acros mit Schärfe-betonendem Entwickler. Mit einem solchen Entwickler landet der PanF bei max. 20 ISO, d.h. er ist zumindest bei Mittelformat nur mit Stativ verwendbar. Die etwas eigenwilligen, noch feinkörnigeren Dokumentenfilme spare ich aus meinen Empfehlungen bewusst aus. - 100-ISO-Klasse: Ilford FP4 Plus, Ilford Delta 100, Kodak Tmax 100 (TMX), Kentmere 100, Fuji Acros II (made in England), Ferrania P33
- 400-ISO-Klasse: Ilford HP5 Plus, Ilford Delta 400, Kodak TriX (400TX), Kodak Tmax 400 (TMY), Kentmere 400
Filme der 100-er Klasse sind super bei gutem Licht im Sommer, bei statischen Motiven und Objektiven mit Bildstabilisator auch ganzjährig. In der dunklen Jahreszeit (Nov. bis Febr.) oder bei Innenaufnahmen ohne Blitz ist meist die 400-er Klasse vorzuziehen. Nach einer bewährten Regel, dass es nichts umsonst gibt, ist das Filmkorn bei den 400-ern gröber, was auch seinen Reiz haben kann. Filme mit Schachtelaufdruck 3200 haben eine Normempfindlichkeit von maximal ISO 1000/31° und können bis zur aufgedruckten Empfindlichkeit gepusht werden (siehe →Pushpfusch). Das sind Spezialfilme und daher für allgemeine Fotografie eher ungeeignet. Am anderen Ende der ISO-Skala kann man mit dem Ilford PanF so ein bisschen Mittelformatqualität auf KB-Film haben.
Neuerdings bieten einige Händler auch hierzulande wieder die alte PAN-Serie von Ilford an (PAN-100, PAN-400), preislich angesiedelt zwischen Kentmere und FP4/HP5-Plus. Ich denke, mit diesen Filmen kann man auch nichts falsch machen. Wo die Qualitätsunterschiede jetzt genau liegen, darüber schweigt sich Ilford aus. Die Top-Qualität steckt sicher in den Delta- und Plus-Filmen.
Dann gibt es als Besonderheit mit S-förmig gekrümmten Kennlinien noch den Ferrania P30 mit einer Nennempfindlichkeit von 80 ISO und den Adox CHS 100 II. Beides sind Neuauflagen alter Filme aus den 50er-60er Jahren und haben für meinen Geschmack eine zu deutliche Ausgleichswirkung bei hohen Motivkontrasten bereits eingebaut. Daher wollen sie gut eingetestet und genau belichtet werden. Sie sind daher keine problemlosen Knips-Filme für Anfänger. Auch sollte man sie auf keinen Fall noch zusätzlich mit →ausgleichenden Entwicklern kombinieren.
Die Markenhersteller bieten reichlich Vielfalt, und das Risiko, dass sie aus dem Filmmarkt aussteigen, ist wieder gesunken. Es gibt daher keinen Grund, auf exotische Randprodukte unter irgendwelchen Handelsmarken auszuweichen. Diese gibt es in kaum mehr überschaubarer Menge und mit oft dubiosem Ursprung, d.h. für Anfänger empfehle ich: Finger weg!
Die Technologie der Filmherstellung ist alles andere als trivial. Nach meinem Kenntnisstand gibt es in Europa derzeit nur wenige Firmen, die das beherrschen: Neben Harman(GB) sind da noch Adox(DE/CH), Foma(CZ) und Ferrania(IT). Bei Agfa Gevaert(BE) ist unklar, ob noch aktuell produziert wird oder ob nur noch Lagerbestände unter den Marken Rollei oder Adox abverkauft werden. Wenn alle Stricke reissen, gibt es (wahrscheinlich mit Qualitätsabstrichen) noch Svema/Astrum (Ukraine) und Tasma (Russland). Filmotec (ehemals ORWO) und Bergger beschränkten sich auf Emulsionsentwicklung und hatten keine eigenen Fertigungsanlagen. Gefertigt wurden deren Filme wahrscheinlich zuletzt von Innoviscoat. Filmotec und Innoviscoat haben im Februar 2022 Insolvenz angemeldet. Alle weiteren Infos aus dieser Ecke sind (vorsichtig ausgedrückt) dubios. Als flexibler Nischenfüller hat sich Adox alias Fotoimpex bewährt, die vor allem Lücken im Chemie-Angebot geschlossen haben. Es gibt berechtigte Hoffnung, dass die verbleibenden Anbieter eine stabile Zukunft haben werden. Was die Verfügbarkeit von SW-Film betrifft, ist mir also noch lange nicht bange. Es gibt ja auch noch Hersteller außerhalb Europas (Kodak, Shanghai)!
Lohnt sich SW-Film als Meterware?
Kurze Antwort, meiner Meinung nach: Nein!
Längere Antwort: Die Preise für 30,5m-Spulen (100 ft) sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Beim Film selbst bleibt nicht viel Ersparnis, und diese wird mit den anfallenden Nebenkosten endgültig aufgezehrt. Man braucht nämlich auch ein Tageslicht-Umspulgerät und spezielle Leerpatronen, die sich öffnen und wieder verschließen lassen und noch lichtdicht sind. Wenn man das alles hat, braucht man noch Zeit, um stumpfsinnig die Meterware in Patronen umzuspulen und mit der Schere die übliche Zunge anzuschneiden. Also mir macht das keinen Spaß. Dazu hatte ich mit Kunststoff-Patronen und deren sehr stramm sitzenden Filzlippen immer wieder Probleme mit nicht konstanten Bildabständen und noch lauter als sonst jaulenden Windern. Daher habe ich für mich beschlossen, keine Meterware mehr zu verwenden.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man bei Meterware beachten sollte und der wichtiger ist, als jede Kostenüberlegung. Bei jeder Befüllung einer Patrone geht der Film 4x durch die Filzlippen am Patronenmaul, bis er endlich zur Entwicklung in die Spirale eingeschoben wird. Auch kleinste, mit bloßem Auge unsichtbare Staubkörnchen erhöhen mit jeder Wiederverwendung einer Patrone kontinuierlich das Risiko, dass die Filme verkratzt werden. Endgültig zweifelhaft sind Filmlader mit eingebauter Filzlippe, in der sich irgendwann todsicher ein hartes Staubkörnchen festsetzt. Der ohnehin geringe finanzielle Vorteil ist dann futsch und man hat wertvolle, nicht wiederholbare Negative für die Tonne.
Interessant wird Meterware möglicherweise, wenn man sehr günstig an 35mm-Kinofilm wie etwa Filmotec Orwo UN54/N75 oder Eastman Double-X auf 400 oder 1000 ft-Rollen rankommt. Zusätzlich braucht man dafür noch Wickelkerne für die 100 ft Tageslicht-Umspulgeräte und muss das in absoluter Dunkelheit umfummeln ohne Fingerabdrücke auf dem Film und ohne dass ein Wickel runterfällt und durch die Dunkelkammer kullert.
Natürlich gibt es immer wieder Fälle, in denen die fertig konfektionierten 36er
Kleinbildfilme für den vorgesehenen Zweck nicht optimal sind. Oft möchte man einfach
nur einen teilbelichteten Film möglichst schnell entwickeln, ohne den Rest
komplett zu verschwenden. Für selbst umgespulte Meterware gibt es folgende naheliegende Alternativen:
a) Einfach die Restbilder auf dem Film als →Testaufnahmen
verknipsen und damit überprüfen, ob die eigenen Prozesse noch das gewünschte Ergebnis bringen. In jedem professionellen
Fotolabor sind solche Tests eine selbstverständliche, regelmäßige Routine.
b) Einen nur teilweise verknipsten Film einfach zurückspulen und eben nur den belichteten Abschnitt entwickeln!
Das geht super-einfach, wie nachfolgend beschrieben.
Entwickeln teilbelichteter Filme
Wenn man nicht gerade ein →einfaches EOS-Modell hat, das den Film beginnend bei Bild 36 rückwärts belichtet, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Film nach X Aufnahmen wie gewöhnlich zurückspulen und die Zahl X irgendwo notieren.
[Wenn man eine Kamera hat, die den Film beim motorischen Zurückspulen unweigerlich ganz in die Patrone einzieht, muss man zunächst die Filmzunge mit einem sogenannten Filmrückholer wieder herauszaubern. Eine Alternative bei solchen Kameras ist, ohne vorheriges Zurückspulen in der Dunkelkammer die Rückwand zu öffnen und den Film mit der Schere abzuschneiden. Weil das gut ausgeprägten Tastsinn und Feinmotorik erfordert, ist das nicht ohne Risiko für den Restfilm, den Schlitzverschluss und die gesamte Kamera.] - Filmzunge auf 76 mm Länge abschneiden, wie man das vor der Entwicklung eben so macht.
- In der Dunkelkammer an Tisch oder Regalbrett eine im Dunkeln tastbare Markierung für die Filmlänge L anbringen, bei der dann abgeschnitten wird. Es gilt L=(X+3)×38mm.
- Am Rest des Films mit der Schere wieder den üblichen Filmanfang zurechtschneiden. Dieser Rest ist anschließend gut für Y weitere Aufnahmen. Es gilt Y=32−X. Man verliert dabei also eine Filmlänge für insgesamt 5 von 37 Aufnahmen. Mit diesem Vorgehen hat man ausreichend Überlappungsreserve, die alle Toleranzen des Filmtransports abdeckt.
Einen kurzen Testfilm belichte ich z.B. vorzugsweise mit 8 Aufnahmen. Der Rest ist nach obiger Rechnung gut für 24 Aufnahmen, die ich zum Abheften ohne weiteren Verschnitt passend in 6er-Streifen aufteile.
Zum Nachrechnen: Ein 36er-Film ist ab Patronenmaul bis Zungenspitze nach ISO 1007 mindestens 1602 mm lang, was normalerweise 37 Aufnahmen erlaubt. Die oben beschriebene Vorgehensweise sollte bei den meisten SLRs mit manuellem Filmtransport passen. Kameras mit integriertem Winder, der nach dem Schließen der Rückwand den Film automatisch bis zu Aufnahme 1 transportiert, verschwenden am Filmanfang oft 1 Aufnahme mehr. Das muss man eben einmal ausprobieren. Dann gilt: L=(X+4)×38mm und Y=30-X
Wie kriegt man den Film in diese Mist-Spirale?
Jeder schwört auf seine Filmentwicklungsdose, mit der er Erfahrung hat - egal ob Jobo, Paterson, AP etc. draufsteht. Aber auch fast jeder hat diese schon einmal verflucht. Allgemeine Tipps sind hier schwierig. Es gibt große/kleine Hände, Links-/Rechtshänder etc., jeder hat eine etwas anders ausgeprägte Feinmotorik. Hier gilt einfach üben, üben, üben! Dazu opfert man am besten einen hoffnungslos abgelaufenen Film (so einen hat doch fast jeder?) und versucht es damit fünfmal mit geschlossenen Augen bei Tageslicht. Dann erst riskiert man die Premiere mit dem ersten richtigen Film in der Dunkelkammer. Selbstverständlich ist die Spirale absolut trocken, und die Zunge eines KB-Films wird vorher abgeschnitten. Das Anschrägen der Ecken kann bei KB-Film nicht schaden, halte ich aber nicht für notwendig.
Bei Rollfilm schnipple ich die Ecken nicht ab, weil mir im Dunkeln ein solches Hantieren mit Schere zu fummelig ist.
Das Hin- und Herdrehen mit dem Zeigefinger in der Mulde, wie es die Jobo-Anleitung zeigt, habe ich noch so gut wie nie gebraucht.
Ich schiebe die Filme einfach rein, auch bei Paterson-Spiralen. Damit ich im Dunkeln nicht nach der Schere tasten muss,
reiße ich den Klebestreifen am Filmende mittig durch. D.h. die eine Hälfte klebt am Film, die andere am Rückpapier.
Es hat auch noch immer funktioniert, mithilfe des roten Nippels 2 Rollfilme hintereinander in eine 1500er Jobo-Spirale einzuschieben.
Ich selbst benutze fast ausschließlich die Jobo 1500er-Dosen, weil diese dicht sind und es bei Bedarf die rote Gummikappe als günstiges Ersatzteil gibt (beim Händler Ihrer Wahl danach fragen). Der zweite Grund ist, dass sie mit nur 250ml Entwickler für einen KB-Film auskommen. Das ist nicht Knauserigkeit, denn sparen kann ich anderswo deutlich effektiver. Wichtig ist mir der sparsame Umgang mit Chemie. Die größeren Dosen der Jobo 2500er-Serie erleichtern angeblich das Einspulen, sind aber für Rotation gedacht. Kippentwicklung damit artet in eine Mucki-Übung aus. 2 KB-Filme erfordern zum Kippen eine Füllmenge von 1275ml, was ich nicht für sinnvoll halte. Ein Systemwechsel kommt für mich daher nicht infrage, weil ich mit meinen uralten Jobo-Dosen dank jahrelanger Übung keine Probleme habe. Was oft empfohlen wird, ist eine Kombination aus dichter Paterson-Dose und kompatibler AP-Spirale mit bequemen Anlageflächen zum Einfädeln.
Einige spezielle Tipps habe ich dennoch:
- Kodak-Tmax-Rollfilme haben mich am Anfang zur Verzweiflung gebracht, weil sie dicker und steifer als andere sind und einen deutlicheren Drall nach innen haben. Der Delta 3200 ist ähnlich dick, aber den verwende ich nicht. Von einem alten Profi habe ich mal den Tipp bekommen, die ersten 5 mm des Rollfilms etwas nach außen umzuknicken. Da kann man beherzt mit seinen Schweiß-Fingern drauftappen, die erste Aufnahme kommt erst einige cm später.
- Wegen angeblich besserer Planlage wickeln etliche KB-Kameras den Film mit der Schichtseite nach außen auf. Das erzeugt je nach Verweildauer in der Kamera einen ausgesprochenen Drall nach außen, was das Einschieben in die Spirale arg erschwert. Solche Filme entwickle ich nicht sofort nach dem Zurückspulen, sondern lasse sie mindestens einen Tag liegen. Dann hat sich dieser Eigendrall entspannt, und ich habe die Filme bisher noch immer problemlos in die Spirale eingeschoben. Wer absolut nicht warten will, kann versuchen, solche Filme mit der Emulsion nach außen in die Spirale zu schieben.
- Ein weiterer Tipp, den ich einmal in irgendeinem Forum aufgeschnappt habe: Damit eine einzelne Filmspirale auf der Jobo-Mittelsäule während des Dosen-Kippens nicht nach oben rutschen kann, sollte man die Mittelsäule mit einer zweiten, leeren Jobo-Spirale auffüllen. Alternativ kann man ein in der Länge passendes Plastikrohr über die Mittelsäule setzen. Im Durchmesser für die 1500er Jobo-Dosen genau passend sind die Plastikröhrchen, in denen Vitamin- oder Aspirin-Brausetabletten verkauft werden. Den Original-Jobo-Dosen liegt auch ein Plastik-Clip bei, der bei heftigem Kippen aber nicht zuverlässig hält. Die Paterson-Spiralen sitzen nach meiner Erfahrung deutlich strammer und benötigen keine extra Sicherung.
- In diesem Zusammenhang möglicherweise auch interessant: Bevor ein Kleinbildfilm IN die Spirale kommt, muss er erst mal AUS der Patrone heraus. Etliche Kameras mit motorischer Rückspulung ziehen den Film unweigerlich komplett in die Patrone ein. Zerstörungsfrei kriegt man den Film nur mit einem „Filmrückholer“ wieder heraus. Alternativ kann man in der Dunkelkammer die Patrone mit einem „Filmpatronenöffner“ knacken.
Muss man Film vor dem Entwickeln vorwässern?
Meine generelle Empfehlung ist ganz klar: nicht vorwässern, einfach weil es nichts bringt! Außer der Hersteller eines gaaanz speziellen Films oder Entwicklers schreibt das ausdrücklich vor. Solche Vorschriften kenne ich für Tanol und Pyro-Entwickler oder für den Bergger Panchro 400. Auch Jobo empfiehlt für die SW-Filmentwicklung in seinen Rotationsprozessoren 5 Minuten Vorwässerung. Das erfordert wiederum lt. Jobo eine um 20-30% verlängerte Entwicklungszeit, was die 20-30% Zeitverkürzung bei Rotation gegenüber Kippentwicklung hoffentlich oder vielleicht wieder kompensiert. Aus Sicht von Jobo ist das also eine sinnvolle Empfehlung, damit man überhaupt mit den Angaben der Film-Datenblätter etwas anfangen kann.
Eine Verbesserung des Entwicklungsergebnisses durch Vorwässern gibt es definitiv nicht. Ilford rät sogar eindeutig davon ab und schreibt dazu: “A pre-rinse is not recommended as it can lead to uneven processing”. Ilford versieht seine Filmoberflächen (außer bei PanF) extra mit einer Gleit- und Netzmittelbeschichtung. Diese soll einen möglichst reibungsarmen Filmtransport in der Kamera, ein einfaches Einspulen in die Spirale und später eine möglichst gleichmäßige und schnelle Benetzung durch den Entwickler sicherstellen. Nach einer Vorwässerung hat sich diese Beschichtung natürlich aufgelöst und ist futsch. Nebenwirkungen durch die typische Schaumbildung beim Entwickeln von Ilford-Filmen hatte ich noch nie. Da nicht alle diese Erfahrung bestätigen, scheint es von der Wasserhärte abhängig zu sein, ob sich überhaupt Schaum bildet. Man darf lediglich die Entwicklermenge nicht zu knapp bemessen, d.h. nicht unter der Empfehlung für die verwendete Dose. Natürlich muss auch sichergestellt sein, dass die Spirale durch heftiges Kippen nicht auf der Mittelsäule nach oben rutscht.
Absolut verboten ist eine Vorwässerung natürlich bei Monobad- und Zweibad-Entwicklern. Auch bei der Entwicklung von Farbfilmen kann eine Vorwässerung ausgesprochen schädlich sein, da bei einigen Filmen eingelagerte Chemikalien am Prozess beteiligt sind. Das kann sich in Farbverschiebungen äußern, die sich nur schwer herausfiltern lassen.
Wenn ein Hersteller für sein Produkt eine Sonderbehandlung wie die Vorwässerung empfiehlt, sollte man im Gegenzug außergewöhnlich gute Ergebnisse erwarten können. Weil ich nicht so recht daran glaube, habe ich mir eigene Versuche mit solchem Material bisher erspart. Ansonsten habe ich bei mittlerweile mehr als 1000 Filmen noch nie das Gefühl gehabt, eine Vorwässerung wäre gut gewesen.
In Fotolaborforen kommen meist Anfänger immer wieder damit an z.B. mit der Begründung, der Film würde den Entwickler anschließend besser aufnehmen. Genau das Gegenteil trifft zu, denn nach Jobo-Anleitung erfordert Vorwässerung eine massive Verlängerung der Entwicklungszeit! Oder im alten Schul-Fotolabor hat der Lehrer immer vorgewässert, und man hat das seitdem so beibehalten. Der Entwicklungsprozess wird mit Vorwässern ein anderer sein. Das Ergebnis wird aber nicht besser, je mehr unnötigen Aufwand man dafür treibt. Mit den genannten Ausnahmen gelten alle mir bekannten Entwicklungszeitangaben aus Datenblättern oder diversen anderen Quellen ohne Vorwässerung. Man müsste dafür alles neu eintesten, und das dann immer gleich machen. Nur wozu? Filmentwicklung ist nichts Kreatives, sondern eine eher stupide Tätigkeit. Ein Arbeitsschritt, der eindeutig keinen Vorteil bringt, ist nur Zeitverschwendung.
Sollte man Film nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums noch verwenden?
Diese Frage kann so pauschal nicht beantwortet werden, es kommt drauf an! Da sich jeder Film ein bisschen anders verhält, basieren die folgenden Grundregeln lediglich auf allgemein anerkannten Erfahrungen.
Die Überlagerung eines Schwarzweißfilms äußert sich in abnehmender Filmempfindlichkeit, abnehmendem Kontrast und vor allem einem hohen Grauschleier (der ist aber noch das kleinste Übel). Niedrigempfindliche Filme bis etwa 100 ISO sind in dieser Hinsicht gutmütig. Ich hätte keine Bedenken, bei einem solchen Kleinbildfilm auch ohne Kühlschranklagerung noch 1-2 Jahre draufzulegen, ohne dass Qualitätseinbußen sichtbar werden. Bei längerer Überlagerung gilt als Daumenregel, dass ein Film je 10 Jahre um 1 EV mehr Licht braucht. Höchstempfindliche Filme reagieren dagegen ganz anders und müssen immer möglichst frisch verwendet werden. Selbst Kühlschrank-Lagerung bringt hier nicht viel, weil der Film durch überall vorhandene radioaktive Grundstrahlung belichtet wird. Ein zwei Jahre alter 3200er hatte bei mir einmal gerade noch 400 ISO! Alle Aufnahmen waren unterbelichtet und kontrastarm, der komplette Film war unbrauchbar. Bei eigenen Käufen achte ich seitdem darauf, dass sich bei mir keine Lagerbestände ansammeln. Wegen der Unsicherheiten verwende ich geschenkte, überlagerte Filme allenfalls zur Überprüfung von Kamerafunktionen oder sie werden gleich entsorgt. Für richtige Fotos ist mir das Risiko zu groß. Lediglich für Anfänger sind solche Filme perfekt geeignet, um das →Einspulen in die Spiralen der Entwicklungsdosen zu üben.
Die genannten Alterungseffekte können durch möglichst kühle Lagerung hinausgezögert werden. Bei vertrauenswürdigen Händlern ist davon auszugehen, dass alle Filme bis zur Auslieferung kühl gelagert wurden. Mit Kurzläufern kann man hier also für kurzfristigen Bedarf durchaus den einen oder anderen Schnäppchenkauf riskieren. Kritischer wird es sicher beim Fotoladen um die Ecke. Bei solchen Notkäufen sollte man einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum werfen!
Besonders sensibel sind offensichtlich 120er Rollfilme. Neben den bisher genannten Alterungserscheinungen können hier noch weitere Fehler auftreten: kleine Punkte oder Marmorierungen, sowie eine Übertragung des Rückpapier-Aufdrucks auf den Film. Probleme macht hier wohl nicht der Film selbst, sondern das Rückpapier. Nach Untersuchungen von Ilford konnten diese Probleme überwiegend auf zu warme, zu feuchte oder zu lange Lagerung nach Entnahme aus der geschweißten Folienpackung zurückgeführt werden. Daher sollte man solche Rollfilme möglichst bald nach der Belichtung entwickeln.
Fazit: Bei der heutigen Angebotsvielfalt im Versandhandel gibt es keinen Grund für Hamsterkäufe, und es ist sinnlos, Filme langfristig auf Lager zu legen. Mehr als einen Jahresvorrat würde ich mir keinesfalls mehr zulegen, selbst wenn ein Angebot noch so verlockend erscheint. Das gilt besonders für Rollfilme. Und keine Sorge: Schwarzweißfilm wird es noch länger geben, das ist meine feste Überzeugung.
Wie vermeide ich Trockenflecken auf dem Film?
Bei Filmen kommen ins letzte Wässerungswasser ein paar (d.h. je 250ml 3-4) Tropfen oder etwa 0,2ml Netzmittel. Für meine Wasserhärte an der Grenze zwischen mittel und hart ist das ist mit ca. 1:1000 deutlich weniger, als die meisten Anleitungen empfehlen. Bei weichem Leitungswasser sollte auch eine Verdünnung 1:2000 ausreichend sein, und bei kalkfreiem Wasser ist Netzmittel ohnehin überflüssig. Wenn das Netzmittelbad mehr als nur ein bisschen schäumt, war auf jeden Fall zu viel drin. Meine 0,5l-Flasche Netzmittelkonzentrat ist also eine Lebensdauerpackung für einen Hobbyknipser. Zur Dosierung fülle ich dieses Konzentrat um in ein 30ml-Aponorm-Fläschchen mit Tropfpipette aus der Apotheke.
Ein Kleinbildfilm, einfach nass zum Trocknen aufgehängt, wird höchstwahrscheinlich üble Trockenflecken aufweisen, die auf den Kalkgehalt des Leitungswassers zurückzuführen sind. Das Netzmittel sollte die Bildung dieser Trockenflecken verhindern, tut das aber wohl nur bei perfekter und an die Wasserhärte angepasster Dosierung, d.h. äußerst selten. Nimmt man zu viel davon, hat man keine Kalkflecken (nicht abwischbar), sondern ebenso hartnäckige schmierige Netzmittelflecken. Seltsamerweise habe ich auf der matten Schichtseite von Kleinbildfilmen noch niemals irgendwelche Flecken gehabt, nur immer auf der unbeschichteten Filmrückseite. Bei mir hat sich Folgendes bewährt: Wenn die Kleinbildfilme im Bad zum Trocknen hängen, wische ich mit zusammengefaltetem Küchenpapier oder einem weichen, nicht fusselnden Geschirrtuch 1x mit leichtem, sanftem Druck den Wasserfilm von der Rückseite (nur dort!) ab. Die feuchte Emulsionsseite ist extrem empfindlich, also dort mit Finger oder Filmabstreifer wegbleiben.
Viele 120-er Rollfilme oder Planfilme haben keine blanke Fläche des Filmträgers, sondern weisen üblicherweise auch auf der Rückseite eine Gelatine-Beschichtung auf, die wegen des dann symmetrischen Aufbaus das Einrollen während des Trocknens verhindert. Diese sogenannte Anti-Curl-Beschichtung fühlt sich in nassem Zustand leicht klebrig an. Daher hatte ich bei Ilford-Mittelformatfilmen auch ohne dieses Abwischen noch niemals Trockenflecken. Aber auch da gibt es Ausnahmen, z.B. die neuen Kentmere-Rollfilme. Diese werden offensichtlich aus denselben Masterrollen geschnitten wie der KB-Film, trotzdem bleiben sie auch ohne Rückseitenbeschichtung schön flach.
Im Gegensatz zu Tipps, die man anderswo lesen kann, erfolgt das Netzmittelbad bei mir in der offenen Entwicklungsdose. Am Ende werden Dose und Spiralen kurz unter fließendem Wasser abgespült. Auswirkungen von Netzmittelresten auf die nächste Filmentwicklung gibt es daher nicht. Wenn es bei der Kipp-Entwicklung dennoch schäumen sollte, liegt das bei manchen Filmsorten an einer Gleit- und Netzmittelbeschichtung der Filmoberfläche. Aufgefallen ist mir das z.B. bei diversen Harman-Filmen und bei Adox CHS100. Eine solche Beschichtung sorgt für reibungsarmen Filmtransport in der Kamera und nach Eingießen des Entwicklers für eine sofortige gleichmäßige Benetzung der Filmoberfläche. Wenn man die Dosenfüllmenge nicht zu knapp bemisst, stört der entstehende Schaum nicht weiter.
Alternative Methoden:
• Kalkfreies (aber nicht keimfreies) Baumarktwasser, das oft als letztes Spülwasser empfohlen wird,
habe ich wegen des Risikos der Schimmelbildung noch nie verwendet.
Ich habe auch einfach keine Lust, ständig Wasser in Kanistern nach Hause zu schleppen!
• Es gibt auch Fotolaborfreunde, die ihre Filme (natürlich noch in der Spirale)
erfolgreich mit einer dafür angeschafften Salatschleuder trocken schleudern.
• Keine Alternative und bei meiner oben beschriebenen Methode auch völlig unnötig: ein Filmabstreifer.
Am besten wirft man den sofort weg, bevor man mit alten Gummilippen riskiert, seine Filme zu verkratzen!
• Auch keine Alternative: Geschirrspülmittel statt speziellem Netzmittel.
Alle Spülmittel enthalten Gelbildner, Parfüme und Farbstoffe,
die man nach Verdunsten des Wassers nicht auf dem Film haben möchte. Manche Spülmittel enthalten zusätzlich
rückfettende Substanzen zur Hautpflege oder Eiweiß-lösende Enzyme, die die Gelatine angreifen.
Die paar Tropfen Netzmittel kosten je Film ca. 1,2 ct, das ist etwa so viel wie 0,0015 Liter Bier
in meiner Lieblingskneipe. Daran (Netzmittel oder Bier) zu sparen, ist für mich keine Option.
Ich habe den XX-Film auf ISO-yy belichtet. Wie lange muss ich entwickeln?
Fotografie auf Film funktioniert so nicht, und diese Frage kann daher kaum sinnvoll beantwortet werden! Man probiert das vorher an einem Testfilm aus, und dann weiß man, ob und wie so etwas geht. Es gibt keine Alternative zu diesem →Eintesten einer Film-Entwickler-Kombination, und das ist gar nicht so kompliziert! Unter anderem kennt man anschließend die tatsächliche Empfindlichkeit dieser Kombination. Meistens liegt diese Empfindlichkeit unter dem Schachtelaufdruck. Mit anderen Entwicklungszeiten ändert man primär den Kontrast eines Films. Als Nebeneffekt kann sich dadurch auch die nutzbare, tatsächliche Filmempfindlichkeit geringfügig ändern! Für die Qualität eines fertigen Fotos ist der →optimale Kontrast genauso wichtig wie eine →optimale Belichtung! Man kann im Einzelfall natürlich einen Spezialentwickler wählen, der die Empfindlichkeit mehr (z.B. Microphen) oder weniger (z.B. Perceptol) ausnutzt. Meine dringende Empfehlung wäre aber, sich zunächst für einen (1!) Universalentwickler zu entscheiden und damit langfristig Erfahrung zu sammeln.
Wenn die Filme schon mit wichtigen Aufnahmen belichtet sind, kann ich nur noch den Rat geben, zur Schadensbegrenzung mit einem weiteren Film Testreihen aufzunehmen und das nachträglich mit einem gezielt ausgewählten →Entwickler →einzutesten. Danach kennt man die wahre Filmempfindlichkeit und man kann das weitere Vorgehen planen.
Sollte es sich nur um eine geringfügige Fehlbelichtung handeln, kann man das getrost vernachlässigen: ½ Blendenstufe Unterbelichtung und mindestens 1-2 Blendenstufen Überbelichtung vertragen alle modernen Filme bei fast allen Motiven ohne nennenswerte Qualitätseinbußen.
Wenn der Film bereits deutlich falsch belichtet wurde, helfen nur Tricks, mit denen man unter sichtbaren Qualitätseinbußen vielleicht noch etwas retten kann. Bei Unterbelichtung hat man die Möglichkeit der verlängerten →Push-Entwicklung, bei der aber infolge des überhöhten Negativkontrastes die Schatten- und Lichterdetails arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Gegenteil im Falle einer Überbelichtung nennt man Pull-Entwicklung, die zu flauem Negativkontrast führt.
Angaben in Datenblättern oder Tipps von anderen Fotografen sind übrigens nur bedingt übertragbar und dienen allenfalls als Startwert für die eigenen Entwicklungsversuche. Bei der Recherche nach Entwicklungszeitempfehlungen findet man immer wieder digitaltruth (USA). Weil dort alles nur ungeprüft aus dubiosen Quellen zusammengesammelt wurde, ohne genaue Nennung von →Kipprhythmus und resultierendem Kontrast (→gamma-Wert), ist das Ganze schlichtweg unbrauchbar. Leider geben auch nicht alle Hersteller-Datenblätter bessere Informationen.
Film A ist okay, aber warum hat Film B immer zu wenig Kontrast?
Einfachste Antwort: Bei Film A bleiben! Das lasse ich hier ausnahmsweise nicht gelten, weil man dann nichts dazulernt.
Andere Antwort: Es wird Zeit, sich mit der fundamentalen Grundlage
der Filmentwicklung zu befassen. Diese lautet: Der Filmkontrast hängt ab
von der Entwicklungszeit, der →Entwicklertemperatur, der Agitation
(genauer gesagt: →Kipprhythmus) und der Entwicklungsaktivität der verwendeten Chemie.
Man kann jeden für bildmäßige Fotografie geeigneten Film auf einen gewünschten Kontrast bringen,
wenn man diese vier Größen gezielt steuert. Der Kontrast, messbar an der Steilheit
der Dichtekurve oder dem →gamma-Wert nimmt zu, wenn man
a) länger entwickelt,
b) bei höherer Temperatur entwickelt,
c) die Dose öfter oder heftiger kippt,
d) die Entwickleraktivität erhöht.
Punkte a) bis c) sind eigentlich klar, aber was bedeutet d)?
Die Entwickleraktivität ist primär vorgegeben durch die chemische Zusammensetzung
des Entwicklers, die wir nicht ändern wollen. Wir können jedoch die Aktivität beeinflussen,
indem wir den Entwickler mehr oder weniger verdünnen und zum Ausgleich die Zeit anpassen.
Vor allem die Sparfüchse unter den Anfängern neigen dazu, die Stammlösung im Verhältnis
1+2 oder 1+3 für die Verwendung als Einmalentwickler zu verdünnen.
Man muss eine geänderte Verdünnung eigentlich als einen anderen Entwickler auffassen,
da nicht alle chemischen Bestandteile bei Konzentrationsänderung gleichermaßen ihre Wirkung ändern.
Neben der Entwickleraktivität ändern wir dadurch auch andere Eigenschaften des Entwicklers,
wie Schärfe, Feinkörnigkeit und Empfindlichkeitsausnutzung.
Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass je zu entwickelnder Filmfläche eine
Mindestmenge an Stammlösung verwendet wird.
Wieviel man mindestens braucht, sollte im Datenblatt des Entwicklers zu finden sein.
Wenn wir das alles beachtet haben, kann immer noch passieren, dass mit zunehmender
Entwicklungszeit die Aktivität durch Oxidation des Entwicklers spürbar nachlässt.
Dies ist der Fall z.B. bei A49 1+1 oder Rodinal 1+50. Diese Entwickler sind spätestens nach
20 Minuten bei üblicher Temperatur (20°C) und dem üblichen 30s- oder 60s-Kipprhythmus
mausetot. Eine Zeitverlängerung bringt hier gar nichts mehr, auf keinen Fall einen
höheren Kontrast. Die anfangs gemachte Beobachtung, dass Film B immer zu wenig Kontrast hat,
kann also für solche Konstellationen durchaus zutreffen. Der Film ist da natürlich unschuldig.
Zur Abhilfe kann nur empfohlen werden, den Entwickler zu wechseln, indem man …
… einen ganz anderen Entwickler verwendet (D-76 oder Xtol halten z.B. länger durch) oder
… den bisherigen Entwickler mit verkürzter Entwicklungszeit in höherer Konzentration verwendet.
Weil 20-minütiges Dosenkippen nicht besonders prickelnd ist und einem den Spaß
am Hobby eher verdirbt, ist auch deswegen ein kürzerer Entwicklungsprozess anzustreben.
Was versteht man unter dem gamma-Wert eines Films?
In guten Entwicklungszeittabellen sind Zeit und Filmempfindlichkeit bei einem bestimmten Kipprhythmus und einem bestimmten γ-Wert gegeben (γ = kleiner griechischer Buchstabe gamma). Fehlen diese wichtigen Informationen, ist auch die angegebene Entwicklungszeit wertlos.
Die Filmempfindlichkeit wird am Belichtungsmesser eingestellt, da gibt es nicht viel zu erklären. Oder doch? - Siehe dazu meine Ausführungen zur →Belichtungsmessung und speziell zur →Graukarte! Der γ-Wert ist eine mindestens genauso wichtige Größe und drückt aus, wie der Film auf unterschiedliche Belichtung reagiert. In einem Diagramm trägt man dazu die gemessenen Dichtewerte D des entwickelten Films über der Belichtung logH auf.
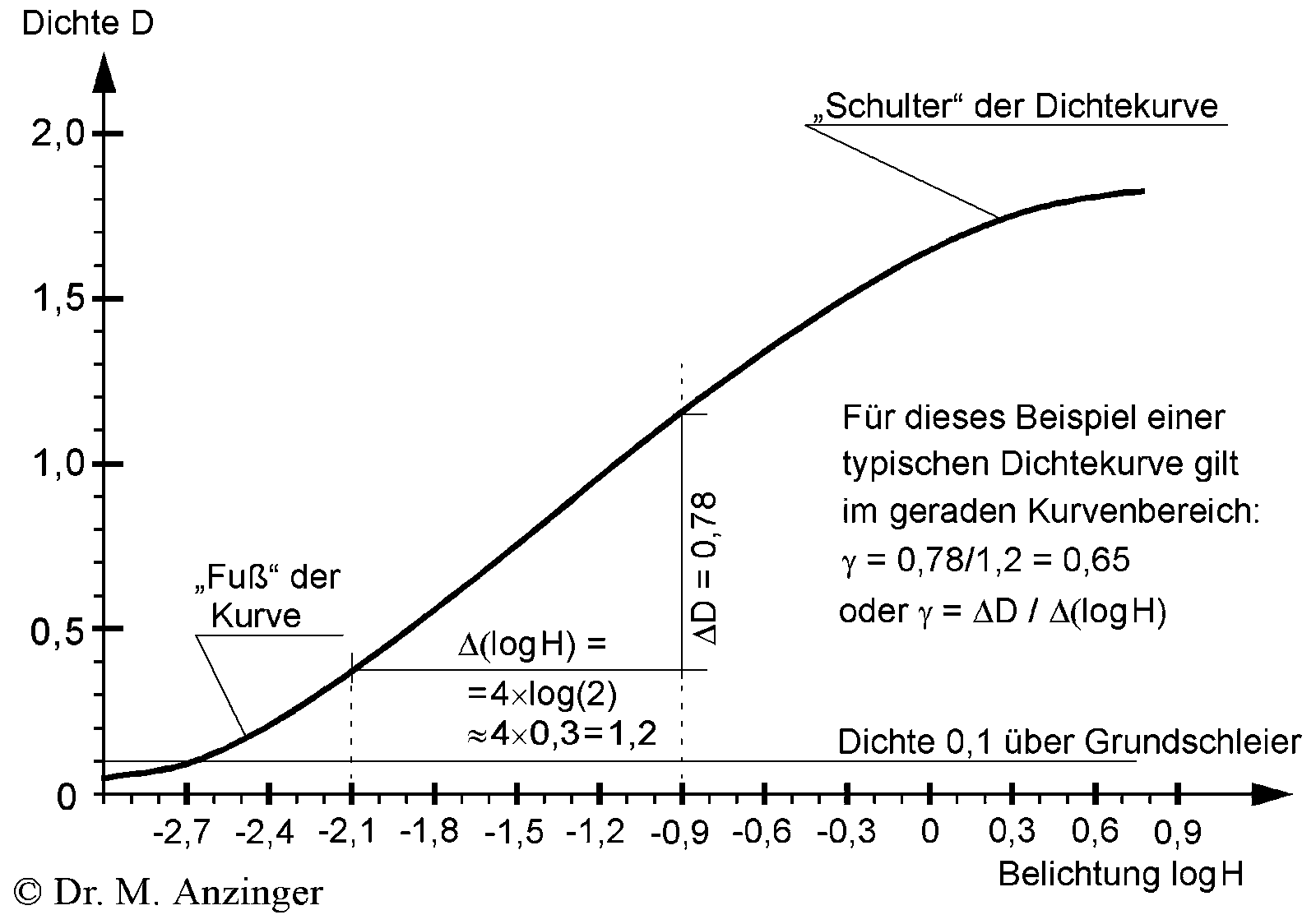 Weil der Kontrastumfang des Fotomotivs und damit der Belichtungsumfang des Films in der Praxis sehr groß werden kann,
wird auf der x-Achse ein logarithmischer Maßstab verwendet.
Damit ergibt eine recht starke Belichtung von H=1lxs (Lux×Sekunde) den Skalenwert log1=0.
Ein Belichtungsunterschied von 1→EV
(Faktor 2) entspricht logarithmisch einer Differenz von Δ(logH)= log(2)≈0,30.
Ein durchschnittlicher Kontrastumfang eines Fotomotivs von 5½ Zeit- oder Blendenstufen
entspricht dann auf der x-Achse einer Differenz von 5,5×0,3=1,65.
Bei dieser Darstellung, der sogenannten Dichtekurve, ergibt sich im Idealfall ein
gerader (linearer) Verlauf im bildwichtigen mittleren Teil, in dem der gamma-Wert definiert wird:
γ = ΔD / ΔlogH.
Weil der Kontrastumfang des Fotomotivs und damit der Belichtungsumfang des Films in der Praxis sehr groß werden kann,
wird auf der x-Achse ein logarithmischer Maßstab verwendet.
Damit ergibt eine recht starke Belichtung von H=1lxs (Lux×Sekunde) den Skalenwert log1=0.
Ein Belichtungsunterschied von 1→EV
(Faktor 2) entspricht logarithmisch einer Differenz von Δ(logH)= log(2)≈0,30.
Ein durchschnittlicher Kontrastumfang eines Fotomotivs von 5½ Zeit- oder Blendenstufen
entspricht dann auf der x-Achse einer Differenz von 5,5×0,3=1,65.
Bei dieser Darstellung, der sogenannten Dichtekurve, ergibt sich im Idealfall ein
gerader (linearer) Verlauf im bildwichtigen mittleren Teil, in dem der gamma-Wert definiert wird:
γ = ΔD / ΔlogH.
Für Interessierte: Die Transmissionsdichte D wird von Densitometern
oder Laborbelichtungsmessern meist direkt angezeigt.
Eigentlich ist auch D ein logarithmischer Wert:
D = log(O) = log(1/T) = −log(T)
mit Transparenz T oder Opazität O
und T = (transmittierter Lichtstrom) / (einfallender Lichtstrom).
Mit diesem γ-Wert wird der Kontrast des Films angegeben, genauer gesagt: die Steilheit der Dichtekurve in deren mittlerem Bereich. Früher, d.h. bis ca. 1960, hatten die Filme eine stark S-förmige Dichtekurve mit einem wenig ausgeprägten linearen Verlauf zwischen Fuß und Schulter. Daher wurden weitere Verfahren definiert, wie ein typischer Steigungswert aus einem nicht immer ideal geradlinigen Kurvenverlauf ermittelt werden kann. Bei Kodak war das der Contrast-Index CI, bei Ilford der G-Wert (“Average Gradient” G‑bar = G mit Querstrich obendrauf). Agfa hat zwar irgendwann den beta-Wert definiert, spricht in seinen späteren Veröffentlichungen aber immer von gamma. Bei vielen Veröffentlichungen und Datenblättern scheinen die Autoren diese Definitionen gar nicht zu kennen und verwenden alles durcheinander, weil man nach den Original-Quellen wohl lange suchen muss. So habe ich z.B. für G in offiziellen Veröffentlichungen bisher vier(!) verschiedene Definitionen gefunden. Die Werte für beta, G und CI berücksichtigen in unterschiedlicher Weise auch den flachen Fußbereich der Kurve und ergeben untereinander ähnliche, jedoch stets kleinere Zahlenwerte als gamma. Erschwerend kommt noch dazu, dass Kodaks CI nur grafisch mit einer Schablone ausgewertet werden kann. Eine einfache Umrechnung zwischen diesen Werten ist nicht möglich, weil sie von der stark schwankenden Form der Dichtekurve im eigentlich uninteressanten Fußbereich abhängen. Für moderne SW-Filme (wie z.B. FP4+, Delta100) gilt für γ = 0,65 etwa CI≈G≈beta = 0,55.
Bei modernen Filmen mit einem langen, gerade verlaufenden Kurventeil kann diese Steigung der Dichtekurve eindeutig und einfach ermittelt werden. In meinen Ausführungen zum Filmkontrast spreche ich daher immer vom γ-Wert.
Weil bei Negativfilmen für bildmäßige Fotografie der Dichteunterschied auf dem Film kleiner ist als der logarithmische Kontrastumfang des Motivs, ist dieser Wert immer kleiner als 1. Ein γ-Wert von 0,70 bedeutet, dass der Film einen hohen Kontrast hat und gut geeignet ist für reine Mischbox-Vergrößerer. Ein hoher Kontrast γ ≈ 0,70, gemessen mit einem Transmissions-Densitometer, wird übrigens auch vorausgesetzt bei der normgemäßen Bestimmung der →ISO-Filmempfindlichkeit. γ=0,50 wäre ein niedriger Kontrast für alte, kontrastverstärkende Kondensor-Vergrößerer. Dabei kann als Randerscheinung die tatsächliche Filmempfindlichkeit leicht 3 DIN niedriger ausfallen als nach ISO-Auswertung. Von Negativen mit Werten im Bereich 0,50-0,70 lassen sich auf Variokontrastpapier normalerweise ordentliche Abzüge anfertigen.
Realistische Entwicklungszeiten kann man nach meiner Erfahrung den Ilford-Datenblättern entnehmen. Die Empfehlungen dort gelten für einen mittleren Kontrast γ ≈ G=0,62 (ein Kompromiss zwischen Kondensor- und Mischbox-Vergrößerer). Wenn der Negativkontrast stark von einem Idealkontrast abweicht, muss man mit extrem weicher oder harter Papiergradation schon ziemlich zaubern, um noch ein brauchbares Bild zu bekommen. Der →Idealkontrast ist abhängig von der Vergrößerbauart, der verwendeten Papiersorte und letztendlich auch vom Motiv. Aufnahmen bei Sonne am Strand sollte man auf ein geringeres γ entwickeln als graue Hauswände bei bedecktem Himmel.
Der ideale gamma-Wert
Man liest überall, dass der Negativkontrast dann ideal sein soll, wenn mit dem verwendeten →Vergrößerer eine gute Vergrößerung mit mittlerer Gradation 2 gelingt. Bei abweichenden Kontrasten kann man dann durch Anpassung der Papiergradation in beide Richtungen ziemlich weit variieren, was im Prinzip richtig ist. Meine langjährige Erfahrung zeigt, dass im Zweifelsfall ein geringfügig höherer Filmkontrast zu besseren Abzügen führt. Die Tonwerte im Negativ sind dann verlustfrei weiter gespreizt und enthalten mehr Details. Diese kann man beim Vergrößern auf →VC-Papier mit Y(ellow)-Filterung problemlos kopieren. Andersrum geht es nicht so gut: In einem weichen, kontrastarmen Negativ sind die Tonwerte zusammengeschoben und enthalten zwangsläufig weniger differenzierbare Details. Was im Negativ nicht drin ist, kann man auch in einem harten Abzug mit M(agenta)-Filterung nicht herausholen. Zusätzlich handelt man sich mit der M-Filterung noch →Unschärfen durch UV-Licht ein.
[In alten Veröffentlichungen wird im Gegensatz zu meinen Erfahrungen genau das Gegenteil empfohlen, z.B. bei Jost Marchesi (1981): Die Ilford-Negativtechnik. Das bezog sich aber auf das Material der 1970er-Jahre, d.h. vergrößert wurde überwiegend mit kontrastreich arbeitenden Kondensor-Vergrößerern auf Papier in festen Gradationsstufen. Da mag das richtig gewesen sein. VC-Papiere in der heutigen Qualität gibt es erst seit 1994.]
Mit fast allen Entwicklern (ausgenommen Monobad- und Zweibad-Entwickler) kann über die Entwicklungszeit der Kontrast bzw. der γ-Wert eines SW-Filmes in weiten Grenzen gesteuert werden. Längere Entwicklungszeiten führen zu einem größeren Negativkontrast. Die echte Filmempfindlichkeit, erkennbar an der Detailzeichnung in den Schattenzonen, erhöht sich dabei nur geringfügig. Die in vielen Hersteller-Datenblättern genannten extremen Empfindlichkeitszunahmen durch längere Entwicklung beziehen sich leider nicht auf die Schattenzeichnung, sondern auf die Dichte der Mitteltöne. Da wird also ordentlich gemogelt, siehe →„Der Pushpfusch“.
Wie wird der gamma-Wert im Hobbylabor ermittelt?
Leider kann man die Größe dieses γ-Werts nicht ohne Weiteres einem Negativ ansehen, weil die Filmdichten von einem Motiv zum nächsten schwanken und auch durch Über- oder Unterbelichtungen beeinflusst werden. Der visuell wahrgenommene Kontrasteindruck wird zusätzlich auch noch durch die Dichte des Filmträgers verfälscht. Für genaue Aussagen zum gamma-Wert hilft daher nur eine systematische Versuchsreihe inkl. Dichtemessung. Dazu muss man Testaufnahmen von einer einheitlich hellen Fläche machen (Blatt Papier, weiße Wand). Ich erspare mir hier weitere Erklärungen und verweise stattdessen auf meine Ausführungen zu diesem Thema. Wenn man damit mal anfängt, ist man ohnehin schon mittendrin beim →densitometrischen Eintesten von SW-Filmen. Ein einfacheres Testverfahren ganz ohne Messgeräte beschreibt das nachfolgende Kapitel.
Warum soll ich meinen SW-Film eintesten?
Beim Stöbern in den einschlägigen Foren stößt man immer wieder auf den Klassiker der Anfänger-Fragen, wie lange man einen bestimmten Film mit einem bestimmten Entwickler optimal zu entwickeln habe. Die Frage kann in dieser Form niemals sinnvoll beantwortet werden! Die sicher zahlreichen wohlgemeinten Antworten sind oft widersprüchlich und tragen nur zur Verwirrung bei. Solche Empfehlungen Anderer sind allenfalls als Startwerte für eigene Versuche zu sehen. Genauso gut kann man auch die Herstellerempfehlungen auf dem Beipackzettel des Entwicklers oder Films für den ersten Versuch heranziehen. Dort kann natürlich immer nur ein Kompromiss angegeben werden. Es gibt da einfach zu viele Einflussgrößen, die sich nicht exakt definieren lassen, z.B. örtliche Wasserqualität, Abweichungen des →Thermometers und des verwendeten →Belichtungsmessers, →Kipp-Rhythmus und -Geschwindigkeit. Weil Datenblätter oder die Ratgeber aus dem Internet alle diese Randbedingungen natürlich nicht kennen, ist es egal, für welche der zahlreichen Empfehlungen man sich entscheidet. Wenn man sich damit zufrieden gibt, dass lediglich das fotografierte Motiv zu erkennen ist, ist das in Ordnung. Aber dann könnte man den Film auch gleich in der nächstbesten Drogerie zur Entwicklung abgeben.
Leider werden nur in wenigen Hersteller-Datenblättern wichtige Angaben zu Kipprhythmus oder Zielkontrast (→gamma-Wert) gemacht, was solche Datenblätter nicht besonders hilfreich macht. Bevor man einen SW-Film mit wichtigen Aufnahmen belichtet und entwickelt, muss die Entscheidung gefallen sein, wie später aus dem Negativ ein fertiges Foto entsteht. Ein optimales Negativ für →digitale Weiterverarbeitung benötigt einen anderen Kontrast als ein Negativ für eine Dunkelkammer-Vergrößerung. Bei reinrassiger analoger Fotografie ist zusätzlich zu beachten, dass der →optimale Negativkontrast an die Bauart des →Vergrößerers und an die verwendete Fotopapier-Sorte (hier: ISO-R-Wert für eine mittlere Gradation 2) angepasst werden muss. Diese beiden zuletzt genannten Einflüsse sind mit Abstand die gravierendsten und werden in keinem Datenblatt genannt. Früher hat Ilford sogar getrennte Entwicklungszeiten für einen Kontrast γ ≈ G 0,56 und 0,70 angegeben. Doch die meisten Anwender haben das nicht verstanden. Ein Kompromiss G 0,62 erschien einfacher. Wenn man nicht alles einer Vollautomatik und einem Großlabor überlassen will, muss man sich tatsächlich schon vor der Einstellung des Belichtungsmessers entscheiden, wie es weiter gehen soll. Zwischen einem idealen Negativ für einen Abzug auf dem alten Ilford Multigrade IV mit einem reinen Mischbox-Gerät und auf IMG V mit einem Kondensor-Vergrößerer liegen Welten! Natürlich gelingt die Dunkelkammerarbeit viel einfacher und besser, wenn man seine Verfahrenskette für die individuelle Ausstattung optimiert.
Oft zeigen Anfänger enttäuscht ihre misslungenen Aufnahmen und möchten wissen, ob und wie die jetzt falsch belichtet oder falsch entwickelt wurden. Dabei ist die Antwort ganz einfach: Vorher ausprobieren, und wenn man dabei nach einem bestimmten System vorgeht, nennt man das „eintesten“. Um ein Eintesten der eigenen Film-Entwickler-Kombination, abgestimmt auf die individuelle Prozesskette bis zum fertigen Bild, kommt man also NIE herum.
Die Vorgehensweise ist unter Fotografen umstritten. Manche behaupten, dass sie ihre Filme grundsätzlich nur nach Herstellerempfehlungen entwickeln, noch nie Probleme damit hatten, und daher die Eintesterei für sinnlos halten. Ich dagegen behaupte, die hatten bisher einfach nur Glück - oder sie geben sich schon damit zufrieden, dass das Motiv wiedererkannt werden kann. Oder sie scannen die Negative nur ein, und biegen den Kontrast digital hin. Aber auch diese →hybriden Fotografen sollten wissen, dass sie Optimierungspotential verschenken.
Filme eintesten ohne Densitometer: Viele alte Hasen tasten sich bei einer neuen und noch unbekannten Film-Entwickler-Kombination dank jahrelanger Erfahrung von Film zu Film gefühlsmäßig an optimale Entwicklungszeit und Filmempfindlichkeit heran. Dabei haben sie aber das unvermeidliche Risiko, dass die ersten 2-3 Filme noch nicht optimal gelingen und im schlimmsten Fall vermurkst sind. Weil diese alten Hasen ihr erprobtes Material nicht ständig wechseln, ist das ein bewährtes Eintest-Verfahren ganz ohne Messgeräte und technischen Schnickschnack. Das geht so:
- Wenn die Schatten im Film keine Konturen zeigen: ISO-Empfindlichkeit des Films halbieren. Den ersten Versuch mit einer unbekannten Film-Entwickler-Kombination bei reduzierter Empfindlichkeit zu beginnen, ist generell eine gute Idee.
- Wenn die Schatten okay sind, aber das Papier sehr lange Belichtungszeiten braucht: Das ist lediglich lästig, aber für hochwertige Filme (mit hoher Maximaldichte) kein ernsthaftes Problem. Man kann Vergrößerungen vereinfachen und gleichzeitig Feinkorn und Schärfe geringfügig verbessern, wenn man die Filmempfindlichkeit in kleinen Schritten erhöht.
- Wenn der Filmkontrast zu hoch ist und man beim Vergrößern überwiegend Gradationen im Bereich 0-1 braucht: Entwicklungszeit auf 80% verkürzen. Wahrscheinlich wird dadurch auch eine etwa 1/3→EV stärkere Belichtung notwendig (d.h. 1 Teilstrich weniger auf der ISO-Skala).
- Wenn der Film zu wenig Kontrast hat und man beim Vergrößern überwiegend Gradationen 3-4 braucht: Entwicklungszeit auf 120% verlängern. Vielleicht kann man den Film gleichzeitig auch etwa um 1/3→EV weniger belichten. Das ist noch kein →„Pushen“, sondern die echte Filmempfindlichkeit für ein perfektes Negativ unter den vorliegenden Randbedingungen.
Schließlich gibt es noch die Anhänger der Densitometer-Fraktion, die grundsätzlich zuerst testen und dann erst fotografieren, und von den anderen oft mitleidig belächelt werden. Ich gebe zu, dass ich mich zu dieser Fraktion zähle, weil es nach meiner Überzeugung der schnellste Weg zu technisch perfekten Negativen ist. Meine wenigen Versuche, nach Herstellerangaben oder dubiosen Internet-Recherchen mit dem ersten Film einer neuen Kombination gleich richtige Fotos zu machen, waren wenig erfolgreich. Ich gebe mich eben nicht damit zufrieden, dass auf einem Film irgendetwas drauf ist. Das hat noch immer funktioniert. Für problemlos vergrößerbare Negative führt aber kein Weg an einem Eintest-Prozess vorbei.
Das Eintesten kann mit wenig Aufwand erledigt werden und es ist ein einmaliger Vorgang, den man nicht ständig wiederholen muss. Nur dadurch habe ich die Gewissheit, dass jeder Film optimal aus der Entwicklungsdose kommt. Weil man danach verstanden hat, wie Schwarzweißfilm funktioniert, ist auch dieser Lerneffekt nicht zu unterschätzen. Um die Prozesse zwischendurch gelegentlich zu überprüfen, habe ich immer wieder mal einen KB-Film mit noch 6 oder 12 Restbildern in der Kamera. Damit ich den endlich entwickeln kann, verknipse ich den mit einer Reihe Testaufnahmen zur →gamma-Kontrolle. Einen systematischen Filmtest mache ich selbst nur noch alle paar Jahre, wenn ich das Bedürfnis habe, einen unbekannten Film oder Entwickler auszuprobieren - und danach lande ich reumütig wieder bei meinen altbewährten Materialien. Das bestätigt regelmäßig die alte Weisheit, dass es keinen Wunderfilm und keinen Wunderentwickler gibt. Meine Erfahrungen beim Eintesten habe ich in einer hoffentlich leicht verständlichen Beschreibung zusammengefasst, und dazu braucht man nicht unbedingt ein Profi-Densitometer, siehe →„Densitometrisches Eintesten von SW-Filmen“.
Dass man nicht nur seinen Film, sondern für die Arbeit mit einem →Laborbelichtungsmesser auch sein →Fotopapier eintesten sollte, steht weiter unten.
Weit verbreitet ist heute eine hybride Arbeitsweise, bei der nur noch der Film altmodisch analog ist und dieser womöglich gar nicht selbst entwickelt, sondern irgendwo zur Entwicklung abgegeben wird. Dann wird gescannt und ausschließlich digital weitergearbeitet. Das Original ist ab jetzt nicht mehr das Negativ. Dichtekurven und Kontraste kann man in der Bildverarbeitung viel einfacher zurechtschieben, als dies bei rein analoger Vergrößerung in der Dunkelkammer möglich ist. Ein exaktes Eintesten hat hier (nur ein bisschen) an Bedeutung verloren. Ein Scanner kann einen deutlich größeren Dichteumfang wiedergeben als jedes Fotopapier. Das optimale Negativ für einen Scanner kann daher nicht gleichzeitig auch optimal für eine analoge Vergrößerung geeignet sein. Auf jeden Fall bezweifle ich, dass ein Bild am PC besser oder billiger gelingt. Als Vorteil sehe ich lediglich die einfache Staubentfernung. Diese digitale Weiterverarbeitung ist ein Thema, auf das ich hier nicht eingehen möchte. Mein persönliches Ziel ist nicht ein Bild auf dem Monitor, sondern immer ein Foto, das ich in die Hand nehmen kann. Und vor allem möchte ich nicht auf das Schönste an diesem Hobby verzichten: den Genuss eines Dunkelkammerabends, bei dem am Ende wundervolle Fotos an der Wäscheleine hängen. Schon Ansel Adams sagte in seiner berühmten Analogie zur Musik: “The negative is the composer’s score, and the print is the performance.” („Das Negativ ist die Partitur eines Komponisten, und der Abzug ist die Aufführung.“)
Was ist eigentlich das „Zonensystem“?
Das Zonensystem wurde Ende der 1930er Jahre von dem amerikanischen Landschaftsfotografen Ansel Adams entwickelt und 1948 in seinem Buch “The Negative” beschrieben. Die verfügbaren Materialien waren zu dieser Zeit natürlich nicht mit den heute erhältlichen vergleichbar. Die Filme hatten eine ausgeprägt S-förmige Kennlinie mit knappem Belichtungsspielraum und für die Vergrößerung im Labor hatte man nicht die Bandbreite an Papiergradationen, die heute selbstverständlich ist. Für ein richtig gutes Foto war eine äußerst exakte Belichtung notwendig, kombiniert mit einer exakt darauf abgestimmten Entwicklung. Unabhängig vom Kontrast der aufgenommenen Szene musste der Grauwertumfang des Negativs perfekt zum Kopierumfang des Fotopapiers passen. Der ehrenwerte Herr Adams musste also mit seiner schweren Großformat-Studiokamera und seinen Materialien eine ganze Weile herumexperimentieren, hat dann in seinem Buch aufgeschrieben, wie so etwas geht, und diese systematische Kontraststeuerung das „Zonensystem“ genannt.
Man braucht bei den heute verfügbaren Film- und Papierqualitäten dieses Zonensystem eigentlich nicht mehr. Aber jeder fortgeschrittene Fotograf sollte es trotzdem kennen, weil damit Begriffe rund um die Belichtungsmessung kurz und prägnant und ohne Logarithmenrechnerei beschrieben werden können. Daher beziehe auch ich mich an vielen Stellen meiner Foto-Seiten auf diese von Adams definierten Zonen.
Adams hat die Graustufen eines Schwarzweißabzugs zwischen Tiefschwarz und Papierweiß mit römischen Ziffern in Zonen von 0 bis X eingeteilt. Zone I unterscheidet sich gerade von Tiefschwarz, d.h. man kann Konturen nur bei Betrachtung in hellem Licht leicht angedeutet erkennen. Zone II enthält die erste zart erkennbare Schattenzeichnung. Eine Belichtung nach Belichtungsmesser ergibt das mittlere Grau der Zone V. Zone VIII ist ein helles Grau mit noch deutlichen Abstufungen, und Zone IX ist fast weiß und fast ohne Zeichnung.
| 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 6 Blendenstufen Kontrastumfang | ||||||||||
Nach diesem System sind maximal die Graustufen von Zone II bis Zone VIII nutzbar. Darunter spricht man von abgesoffenen Schatten, darüber von ausgefressenen Lichtern. Perfekt strukturierte Schatten mit gut erkennbaren Details sollte man eher in Zone III legen. Das ist der Referenzpunkt, den vor allem die Großformat-Fotografen anstreben.
Tipp: Wenn Sie einen hochwertigen Monitor haben und dieser richtig eingestellt ist, sollten Sie in den Zonenfeldern I und IX gerade noch andeutungsweise eine schwarze bzw. weiße Zonen-Nummer lesen können. Die Ziffern II und VIII sollten bereits deutlich lesbar sein.
Grundsätzlich gilt: Das Zonensystem in seiner ursprünglichen Anwendung ging davon aus, dass man alle Negative auf Papier ein und derselben mittleren Gradation kopiert, eben weil es in den 1930ern nicht die heute übliche Gradationsauswahl zwischen weich und hart gab! Daher kann man eine Zone des Papierabzugs direkt einer bestimmten Dichte (= Zone) des Negativs zuordnen. Im Negativ ist lediglich die Reihenfolge der Zonen anders herum. Zone I ist dort die Belichtung, die sich mit leichtem Grau (genauer: Dichte 0,1) gerade eben vom durchsichtigen Filmträger abhebt.
Bei sogenannter Normal- oder N Entwicklung des Films und Abzug auf Papier mittlerer Gradation entsprechen diese Zonen II-VIII einem Kontrastumfang des Motivs von 6 →EV (bzw. 6 Blendenstufen). Bei höherem Motivkontrast muss man durch angepasste Entwicklung die Negativkontraste auf einen geringeren →gamma-Wert zusammenquetschen (N−1 bei 7 Stufen Kontrastumfang), bei geringerem Motivkontrast auseinanderziehen (N+1 bei 5 Stufen Kontrastumfang des Motivs). Das heißt, Belichtung und Entwicklung jeder einzelnen Aufnahme sollte für eine optimale Vergrößerung angepasst werden an den vorhandenen →Kontrastumfang des Motivs. Das ist natürlich nur mit Spot-Belichtungsmesser, Planfilm und Großformatkamera möglich. Leider gibt es keine allgemein gültigen Faktoren, mit denen man eine bewährte Zeit für eine N Entwicklung auf N−1 oder N+1 umrechnen kann. Jeder Entwickler und jeder Film reagiert etwas anders. Als Basis für eigene Versuche gilt für N−1 ca. 20% weniger Zeit, für N+1 20-25% mehr Zeit oder alternativ eine Temperaturerhöhung um 2°C.
Ich spare mir jetzt hier weitere Details dazu. Neben den Original-Büchern von A.Adams, die eine gut sortierte öffentliche Bibliothek haben sollte, gibt es auch im Internet ’zig Beschreibungen. Mein Tipp wäre eine kurze Erklärung (pdf) von Harald Furche aus dem alten Schwarzweiss-Magazin, oder die mehrteilige Serie „Schritt für Schritt zum Zonensystem“ von Wolfgang Mothes.
Moderne Filme (nicht nur die →Flachkristaller), verarbeitet in modernen Entwicklern, sind seit Adams’ Zeiten sehr viel toleranter geworden und haben meist eine ausreichend lange lineare Kennlinie. Dank Gradationswandelpapier und Vergrößerer mit Farb- oder VC-Filterkopf haben wir aus einer Schachtel alle Gradationen von 00 bis 5 stufenlos. Eigentlich ist die analoge Fotografie aufgrund Ihrer Fehlertoleranz das ideale Anfänger-Medium. Das war damals noch ganz anders. Anfänger und Amateure versteckten die technischen Unzulänglichkeiten, weil sie im Fotoladen um die Ecke nur Kontakte vom 6×9-Negativ machen ließen. Ein damaliges Negativ richtig vergrößerungsfähig zu bekommen, war eine handwerkliche Herausforderung.
Heute kann das jeder schaffen! Dazu habe ich folgende Empfehlungen:
Typische Fotopapier-Daten entnehme ich hier dem Datenblatt von Ilford Multigrade V RC.
Andere Papiere haben eine vergleichbare Gradationsspreizung.
Den Film belichte und entwickle ich immer so, wie es sich durch →Eintesten
ergeben hat, d.h. gerade nutzbare Schattenzeichnung in Zone II und ein an den Kontrast
meines Dunco-Vergrößerers angepasster →gamma-Wert.
Dann sollten gute Abzüge mit folgenden Einstellungen gelingen:
- Motivkontrast 4 Blendenstufen: Papiergradation 4
- Motivkontrast 5 Blendenstufen: Papiergradation 2,75
- Motivkontrast 6 Blendenstufen: Papiergradation 2
- Motivkontrast 7 Blendenstufen: ½ Blende überbelichten, Papiergradation 1,25
- Motivkontrast 8 Blendenstufen: 1 Blende überbelichten, Papiergradation 0,5
Die genannten Überbelichtungen gelten relativ zu einer üblichen integralen Belichtungsmessung oder auch einer Lichtmessung mit Handbelichtungsmesser. Besser wäre natürlich eine Spotmessung auf dunkle Schatten, die man in Zone II legt. Achtung: Eine Messung auf eine →18%-Graukarte wäre sinnlos, bzw. müsste umständlich korrigiert werden. Handwerkliche Probleme kann es im Fotolabor allenfalls noch bei Vergrößerung auf die harten Gradationen 4-5 geben, weil man hier Belichtungsunterschiede von 1/12 Blendenstufe im direkten Vergleich der Lichter deutlich erkennt. Man muss also mit dem perfekt kalibrierten Laborbelichtungsmesser genau messen, oder Probestreifen in sehr kleinen Belichtungsschritten machen. Weiche Gradationen sind hier gutmütiger, so dass ich(!) eher Gradation 1,5 als normal ansehe und dafür den Film auf einen geringfügig höheren Kontrast entwickle. Es gibt auch noch andere Gründe, warum ich den →idealen gamma-Wert etwas höher wähle und lieber im Y-Bereich der Farbfilterung arbeite.
Die Wundermittel, mit denen die alten Handwerker den Kontrast gesteuert haben, funktionieren immer noch, egal ob mit modernem oder altmodischem Material. Es ist sogar äußerst lehrreich, das auch mal alles selbst auszuprobieren. Jeder fortgeschrittene Schwarzweiß-Fotograf sollte das Zonensystem verstanden haben. Die seit Ansel Adams geltende Regel „Belichte auf die Schatten - entwickle auf die Lichter“ ist zwar nicht falsch, man sollte sich aber nicht allzu sklavisch an perfekter Schattenzeichnung orientieren. Der mit dem ersten Blick auf ein Foto erfasste Bildinhalt ist meistens auf das beschränkt, was in den Lichtern dargestellt ist. Ausgebrannte Lichter finde ich daher oft schlimmer als abgesoffene Schatten.
Die konkreten Empfehlungen von St.Ansel gelten für das fotografische Material der 30er-Jahre. Ich behaupte daher: Wer mit dem heute verfügbaren Qualitätsmaterial noch meint, mit Zonensystem und/oder →Vorbelichtung tief in die Trickkiste greifen zu müssen, wird nach meiner eigenen Erfahrung nicht unbedingt ein besseres Foto machen. Ausnahmen bestätigen diese Regel, siehe das nachfolgende Kapitel.
Ich behaupte aber auch: nicht alle Hobbyfotografen sind begnadete Fotokünstler.
Viele sind - wie auch ich - schlicht begeistert von dieser Technik
und der Arbeit in ihrem Schwarzweiß-Labor. Auch wenn ich persönlich nichts davon halte,
kann unter diesem Blickwinkel die praktische Anwendung des Zonensystems
sogar heute noch angebracht sein.
Davon abgesehen: Diese individuelle Optimierung jeder einzelnen Aufnahme ist
natürlich nur sinnvoll bei Planfilm in Großformatkameras.
Und wer vor diesem Aufwand nicht zurückschreckt, für den ist
die konsequente Anwendung des Zonensystems inklusive
Spotbelichtungsmessung ohnehin nicht mehr so abwegig.
Was bewirkt eine Vorbelichtung des Films?
Wer mit Roll- oder Kleinbildfilm alle Aufnahmen auf einem Film gemeinsam entwickeln muss, kann das →Zonensystem in seiner strengen Anwendung ohnehin vergessen. Damit ist die Fotografie im Grenzbereich sehr hoher oder niedriger Kontraste ein ständiger Kompromiss. Falls der Motivkontrast zu gering ist, habe ich leider keinen Tipp, außer den gesamten Film länger und kontrastreicher zu entwickeln. Wenn aber der Kontrast eines unwiderstehlichen Motivs für den Film und die dafür vorgesehene Entwicklung zu hoch ist, kann man mit Vorbelichtung einzelne Aufnahmen gezielt weicher bekommen. Typische, sehr kontrastreiche Szenen sind Schneelandschaften oder Strand in greller Sonne und auch so gut wie alle Nachtaufnahmen.
Wer seinen Film eingetestet hat, weiß, wie viel Licht für gerade erkennbare Schattenkonturen erforderlich ist (Zone II). Mit dieser Belichtung muss eine diffuse Vorbelichtung erfolgen. Diffus heißt: ohne Konturen, mit möglichst offener Blende und unscharfem Fokus einfach auf den blauen Himmel oder eine andere einheitlich helle Fläche zielen, Belichtung messen und den Film, der später wie gewohnt auf normalen Kontrast entwickelt werden soll, jetzt mit 3 Stufen (bzw. Zonen) Unterbelichtung vorbelichten. Anschließend wird das gewünschte Motiv wie gewohnt auf das gleiche Negativ aufgenommen, d.h. wir machen eine Doppelbelichtung! Ob diese Vorbelichtung vor oder nach der eigentlichen Aufnahme erfolgt, ist egal.
Was soll das jetzt?
Für eine normale Belichtung gilt bei konstant gehaltener Blende zum Beispiel
der nachfolgend dargestellte Zusammenhang zwischen Zone und Belichtungszeit.
Zone V (im Beispiel dieser Tabelle bei 1/60 ≈ 0,016 s) entspricht
hierbei einer Belichtung nach Anzeige des Belichtungsmessers.
Die unteren zwei Zeilen der Tabelle gelten für eine Vorbelichtung von 1/500 s,
d.h. mit einer der Zone II entsprechenden Lichtmenge.
| Zone | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel.-zeit t in s (Beli: 1/60s) |
1/1000= 0,001s |
1/500= 0,002s |
1/250= 0,004s |
1/125= 0,008s |
1/60≈ 0,016s |
1/30≈ 0,031s |
1/15≈ 0,063s |
1/8= 0,125s |
1/4= 0,250s |
| logarithm. Bel. Δ log(t) |
0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
| Vorbel. 1/500s + Belichtg. lt. Beli |
0,003s | 0,004s | 0,006s | 0,010s | 0,018s | 0,033s | 0,065s | 0,127s | 0,252s |
| Δ log(t) mit Vorbel. 0,002s |
0,48 | 0,60 | 0,78 | 1,00 | 1,26 | 1,53 | 1,82 | 2,11 | 2,41 |
Anmerkung: Es ist von Vorteil, bei Filmbelichtung logarithmisch zu denken. Die Auswirkung der Vorbelichtung erkennt man daher besonders gut bei Vergleich der beiden Tabellenzeilen mit den logarithmischen Werten. 1 Zone bzw. 1 Belichtungsstufe in obiger Tabelle entspricht bei der Belichtungszeit dem Faktor 2 und log(2)≈0,30.
Bei einer Vorbelichtung mit einer der Zone II entsprechenden Lichtmenge erhält JEDE Zone dieses Licht zusätzlich. Zone II z.B. erhält die doppelte Belichtung, wird überbelichtet und damit auf Stufe III mit perfekten Schattendetails angehoben. Zone I wird noch stärker angehoben und erhält bereits eine Schattenzeichnung, die sonst für Zone II-III typisch ist. Die Dichtekurve des Films wird im Bereich der Schatten also nach oben gebogen, was die Schattenzeichnung sichtbar verbessert. Ohne Vorbelichtung wären diese Schatten „abgesoffen“. Zone V in meinem Beispiel mit nominell 1/60 ≈ 0,016s erhält zusätzlich ebenfalls 0,002s mehr, was vernachlässigbar ist. Diese Differenz ist wahrscheinlich geringer als die Wiederholgenauigkeit des Verschlusses. Das gilt erst recht für die noch längeren Zeiten. Die Mitteltöne und Lichter bleiben trotz Vorbelichtung also unverändert erhalten.
Der Film wirkt durch diesen Trick insgesamt weicher. Der verringerte Gesamtkontrast erleichtert in folgenden Fällen hoffentlich eine gute Vergrößerung:
- Bei Bildern mit extremen Lichtern kann man jetzt um eine Stufe unterbelichten und möglicherweise die Lichter noch retten, ohne dass die Schatten absaufen. Der Film verhält sich so, als hätte er eine erhöhte Empfindlichkeit und das ohne Push-Entwicklung. Adox nennt das bei seinem HR-50 folgerichtig auch “Speed Boost”. Da sich dahinter ein hart arbeitender Luftbildfilm von Agfa-Gevaert verbirgt, kann dieser die erhöhte Empfindlichkeit und den weicheren Kontrast dringend gebrauchen.
- Bei Filmen, die gepusht werden sollen, kann man noch ein wenig Schattendetails herauskitzeln. Überstrahlte Lichter sind damit nicht zu retten.
Falls eine solche Vorbelichtung noch nicht ausreicht, hohe Kontraste zu bändigen, bleibt nur die Möglichkeit, mit angepasster Entwicklung zusätzlich die Dichtekurve flach zu biegen: entweder durch „Pullen“ oder mit Hilfe eines →Ausgleichsentwicklers, der nur die Lichterzonen nach unten holt. Dieser Einfluss der Entwicklung wirkt sich natürlich auf den gesamten Film aus und nicht nur auf einzelne Aufnahmen.
Was man für eine solche Vorbelichtung zwingend braucht, ist eine Kamera, die Doppelbelichtungen zulässt und den Filmtransport vom Aufziehen des Verschlusses trennt. Bei den alten Canons ist das nur bei der EF, A1 oder T90 vorgesehen, meine EOS-Gehäuse beherrschen das alle. Und nicht zu vergessen: meine alte Rolleiflex F kann das auch. Bei vielen anderen Kleinbildkameras ohne motorischen Filmtransport kann man sich so behelfen:
- den losen Filmwickel in der Patrone mit der Rückspulkurbel leicht spannen;
- a) Kurbel festhalten, b) Rückspulentriegelung drücken und gedrückt halten, c) Verschluss spannen - und das alles gleichzeitig: eine leicht artistische Übung mit am besten drei Händen;
- Doppelbelichtung machen;
- Wenn der Rückspulknopf beim nächsten Filmtransport wieder zurückspringt, wird wahrscheinlich keine volle Bildlänge weitertransportiert, sondern vielleicht nur 2/3. Diese Aufnahme daher „leer“ belichten, z.B. mit aufgesetztem Objektivdeckel. Beim nächsten Filmtransport stimmt wieder alles, außer das Zählwerk.
Bei moderneren Gehäusen mit motorischem Filmtransport kann man sich wie folgt behelfen: Filmanfangsposition vor dem Schließen des Rückdeckels mit Folienstift markieren und den gesamten Film mit genau dieser Anfangsposition ein zweites Mal durchziehen. Diese Methode ist lediglich dann nicht ganz einfach, wenn die Kamera beim Zurückspulen den Filmanfang ganz in die Patrone einzieht. Hier hilft ein sogenannter „Filmrückholer“ (oder engl.: “Film Picker“, “Leader Retriever”) mit dem man bei Tageslicht die Filmlasche wieder herauszaubern kann.
Bevor ich selbst mit Vorbelichtung herumspiele, genügt es fast immer, mit Hilfe von Spotmessung auf dunkle Schatten zu belichten (die kommen um drei Blenden unterbelichtet in Zone II) und später weich abzuziehen. Der Überbelichtungsspielraum moderner Filme und der Kopierumfang moderner Gradationswandelpapiere lassen hier einiges zu. Sollte ein Abzug mit Gradationsfilterung 00 immer noch zu hart sein oder als Alternative zur mühsamen Nachbelichtung der Spitzlichter, kann man selbstverständlich auch das Fotopapier vorbelichten. Das wird sicher einige Probestreifen erfordern, ich habe leider noch keine eigenen Erfahrungen damit.
Wie funktioniert „Pushen“? - oder „Der Pushpfusch“
„Pushen“ bedeutet, aus einem Film eine höhere Filmempfindlichkeit herauszuholen, als er eigentlich hat. Dazu wird der Film zunächst bewusst unterbelichtet, und durch eine Überentwicklung soll das dann wieder ausgeglichen werden. Eigentlich sind das gleich zwei Todsünden, wenn man ein ausgeglichenes Negativ mit schönen Grauwerten anstrebt. In den Beipackzetteln mancher Filme oder Entwickler ist sogar beschrieben, wie man durch Verlängern der Entwicklungszeit locker eine vier- oder gar achtfache ISO-Empfindlichkeit herausholen kann. Mal ehrlich, jeder hätte doch gerne ein paar PS mehr unter der Haube, und das ohne Aufpreis! Leider ist das blanker Unfug, der durch Protz-Marketing mancher Film- und Entwicklerhersteller auch noch gefördert wird! Als jugendlicher Anfänger bin ich da natürlich auch darauf hereingefallen und war von den Ergebnissen erst mal frustriert.
Die Empfindlichkeit eines Schwarzweißfilms ist frei nach ISO-Norm ungefähr so definiert, dass bei Entwicklung auf einen Kontrast von →gamma≈0,70 die um 4 Blendenstufen unterbelichteten Schattenzonen im Negativ zwar schon eine geringe Dichte aufweisen, sich aber kaum vom meist graublau gefärbten Filmträger abheben. Sie sind kontrastarm und ohne Details (Empfindlichkeitspunkt der Dichtekurve bei D=0,1). Negativstellen mit 3 Blendenstufen Unterbelichtung sollten bereits Details mit beginnender Tonwerttrennung aufweisen (für die Spezialisten mit Densitometer: mindestens D=0,2). Diese so ermittelte Filmempfindlichkeit ist häufig niedriger als die vom Hersteller im Datenblatt angegebene Nenn-Empfindlichkeit. Jede Film-Entwickler-Kombination hat demnach eine bestimmte typische Filmempfindlichkeit. Mit einer Überentwicklung kann man den Filmkontrast erhöhen, mit einer →ISO-Empfindlichkeit hat das dann natürlich nichts(!) mehr zu tun.
So, jetzt endlich zum Pushen:
Natürlich kann man am Belichtungsmesser eine höhere ISO-Zahl einstellen und den Film bewusst unterbelichten.
Bei Standardentwicklung wird ein mittlerer Grauton (z.B. Hautfarbe) dann auf dem unterbelichteten Negativ zu hell,
und in den Schatten ist gar keine Zeichnung mehr vorhanden.
Das muss jetzt durch Pushen, d.h. durch verlängerte Entwicklung ausgeglichen werden.
Dafür verwendet man natürlich auch Entwickler, welche die Filmempfindlichkeit gut ausnutzen.
Also in diesem Fall Finger weg von Feinkorn- und Schärfe-optimierten Entwicklern!
Es ist nun leider eine Tatsache, dass jeder Film eine Mindestlichtmenge
braucht, damit überhaupt latente Silberkeime entstehen. Da kann man entwickeln, wie man will:
bei Unterbelichtung kommt in den Schatten nichts. Nur dort, wo schon eine Mindestbelichtung erfolgt ist,
kann durch stärkere Entwicklung die Filmschwärzung erhöht werden. Der auf dem Negativ
zu helle Hautton erreicht dann wieder eine mittlere Dichte, und man kann von einem solchen
Negativ zumindest die bildwichtigen Mitteltöne wieder auf’s Papier bringen. Leider wirkt
eine verlängerte Entwicklung auch auf die Lichterpartien, die im Negativ viel zu dicht werden
und auf dem Abzug rein weiß kommen. D.h. Schatten sind ohne Zeichnung tiefschwarz, die Lichter
sind ohne Zeichnung rein weiß, nur die Mitteltöne passen einigermaßen. Auch ein Abzug
mit weicher Gradation kann hier nicht retten, was auf dem Negativ einfach nicht drauf ist.
Ein “fine art print” wird das so nie! Das Ganze ist ein Notbehelf, wenn man vor der Wahl steht,
entweder ein gepushtes, extrem kontrastreiches Negativ zu erhalten - oder gar keines.
Wie so etwas in einer densitometrischen Dichtekurve aussieht, habe ich versucht,
in folgendem Bild darzustellen.
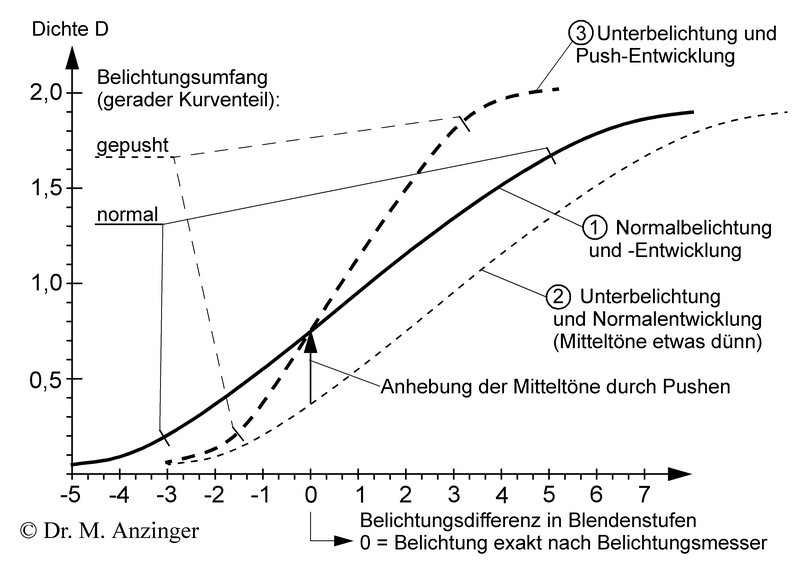 Die durchgezogene Linie 1 zeigt die typische Dichtekurve eines normal belichteten und entwickelten Negativs.
Der Belichtungsumfang, erkennbar am weitgehend geradlinigen Teil der Kurve,
beträgt in diesem Beispiel 8 Blendenstufen (-3…+5).
Durch Unterbelichtung (hier um 2 Blendenstufen) wird diese Dichtekurve nach
rechts verschoben (Linie 2) und das ganze Negativ wird dadurch recht dünn.
Durch verlängerte Pushentwicklung wird die Kurve steiler und die Mitteltöne werden wieder auf das
ideale Niveau angehoben (Linie 3). Allerdings wird der Negativkontrast größer und der Belichtungsspielraum kleiner,
ablesbar am weitgehend geraden mittleren Teil der Dichtekurve, der hier nur noch etwa 4,5 Blendenstufen umfasst (-1,5…+3).
Die durchgezogene Linie 1 zeigt die typische Dichtekurve eines normal belichteten und entwickelten Negativs.
Der Belichtungsumfang, erkennbar am weitgehend geradlinigen Teil der Kurve,
beträgt in diesem Beispiel 8 Blendenstufen (-3…+5).
Durch Unterbelichtung (hier um 2 Blendenstufen) wird diese Dichtekurve nach
rechts verschoben (Linie 2) und das ganze Negativ wird dadurch recht dünn.
Durch verlängerte Pushentwicklung wird die Kurve steiler und die Mitteltöne werden wieder auf das
ideale Niveau angehoben (Linie 3). Allerdings wird der Negativkontrast größer und der Belichtungsspielraum kleiner,
ablesbar am weitgehend geraden mittleren Teil der Dichtekurve, der hier nur noch etwa 4,5 Blendenstufen umfasst (-1,5…+3).
Pushen bewirkt im Prinzip also keine Empfindlichkeitssteigerung, sondern eine Kontraststeigerung. Wenn man will, kann man das als Gestaltungsmittel einsetzen. Nur leider setzen viele Anfänger das Pushen dann ein, wenn sie wegen wenig Licht gerne eine höhere Empfindlichkeit hätten. Genau solche Situationen weisen aber oft extreme →Motivkontraste auf, wie z.B. bei Nacht- oder Bühnenaufnahmen. Diese Kontraste werden durch Pushen noch verstärkt, und das kann nicht immer gut gehen. Für ein technisch perfektes Bild müsste man den Film bei solchen Motiven „pullen“, d.h. mit reduzierter Filmempfindlichkeit überbelichten (genauer gesagt: →richtig belichten) und dann mit verkürzter Entwicklungszeit auf einen idealen Kontrast bringen, bei dem problemlose Vergrößerungen gelingen. Da technische Perfektion natürlich nicht das alleinige Merkmal eines guten Fotos ist, hat eine bewusst angewandte Push-Entwicklung durchaus ihre Berechtigung in den Grenzbereichen der analogen Fotografie bei wenig Licht.
Wenn man als Ziel ein technisch perfektes Bild hat, ist Pushen ein hervorragendes Verfahren für Fotos bei geringem Motivkontrast, genauso wie Pullen für sehr hohen Motivkontrast. Die anzupassende Filmempfindlichkeit ist hierbei ein lästiger Nebeneffekt, der natürlich auch beachtet werden muss. Noch einmal zur Wiederholung: Pushen und Pullen sind in Wirklichkeit gezielt angewandte Kontraststeuerungen! Wer diese Verfahren nur zur Manipulation der Filmempfindlichkeit einsetzt, muss eben mit den Schwierigkeiten eines völlig danebenliegenden Negativkontrastes sehen, wie er zurechtkommt.
So nebenbei ist jetzt auch die immer wieder gestellte Frage beantwortet, was besser ist: einen feinkörnigen 100er Film um 2 Stufen zu pushen oder gleich einen 400er zu nehmen. Ich ziehe da auf jeden Fall den 400er vor, da mich ein wenig mehr Korn selten stört. Dafür erspare ich mir den Laborfrust, von einem extrem kontrastreichen gepushten Negativ einen halbwegs brauchbaren Abzug zu machen. Bei der Entscheidung 400er oder 1600-3200er tendiere ich dagegen zum mäßig gepushten HP5+. Der Grund dafür ist ganz einfach: Empfindlichkeiten ab ISO-800 brauche ich so selten, dass ich für diese Ausnahmen keinen Spezialfilm auf Lager legen möchte. Und ich behaupte jetzt mal ganz provokant: ISO-3200 oder noch mehr braucht sowieso kaum einer. Wo kein Licht ist, gibt’s auch nichts zu knipsen! Daher sind für mich aufwändige Spezialbehandlungen in Zweibad-Entwicklern nicht relevant, bei denen aus einem 400er angeblich bis zu 12500(!) ISO herausgeholt werden können. Für mich sind das lediglich Experimente, deren Sinn ich für fragwürdig halte. Als Nachtsichtgerät sind aktuelle Digitalkameras deutlich besser geeignet.
Entwicklungsfehler und deren Vermeidung
Die mit Abstand häufigsten Fehler bei der Filmentwicklung liegen an einer falschen Entwicklungszeit aus irgendwelchen Datenblättern oder dubiosen Internet-Quellen wie z.B. digitaltruth. Kombiniert wird das oft noch mit Unterbelichtung, weil die aktuelle Film-Entwicklerkombination einfach nicht die auf der Schachtel aufgedruckte Empfindlichkeit erreicht. Ein solcher Film hat dann nur eher zufällig optimalen Kontrast und ausreichende Dichte, damit nachfolgend optimale Papierbilder gelingen. Das kann man leicht beheben, wenn man seine Film-Entwickler-Kombination →systematisch eintestet. Das ist gar nicht so kompliziert, wie viele meinen, und man braucht dazu auch keine spezielle Ausstattung (die wäre lediglich “nice to have”).
Die zweithäufigsten Fehler, für die in Fotoforen regelmäßig Abhilfe gesucht wird, liegen nicht am Film, sondern am Scanner und dem nicht fachgerechten Umgang damit. Eine solche hybride Arbeitsweise ist heute weit verbreitet. Ob der Fehler am Negativ oder am Scan liegt, kann man leicht mit Lupe und einem genaueren Blick aufs Negativ herausfinden. Weitere Tipps kann und möchte ich hierzu nicht geben, sondern mich nachfolgend bewusst auf den analogen Prozess beschränken.
In alter Fotolabor-Literatur und auch in Forumsbeiträgen geistern immer wieder Erklärungen herum, welche üblen Fehlerquellen es beim Entwickeln von SW-Filmen sonst noch geben könnte und wie man sie vermeiden kann. Ich habe hier mal die Dauerbrenner herausgepickt. Leider kann ich die folgende Liste nicht mit eigenen Bildbeispielen schmücken, da ich selbst bei über 1000 Filmen mit Ausnahme der unten genannten Rostpartikel solche Fehler noch nicht erzeugt habe. Vielleicht war es bisher nur ein glücklicher Zufall, dass ich verschont geblieben bin. Ich bilde mir aber eher ein, dass ein sorgfältiges und immer konstantes Vorgehen belohnt wird, ohne dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Eine Beschränkung auf bewährte Markenfilme kann zusätzlich sinnvoll sein, um Herstellfehler als Fehlerquelle weitgehend ausschließen zu können. Einige der nachfolgend genannten Fehler sind durch verbessertes Filmmaterial längst ausgemerzt, werden aber trotzdem mit schöner Regelmäßigkeit diskutiert.
• Bei den extrem dünnen Emulsionen hochauflösender Dokumentenfilme hat man früher (d.h. vielleicht gerade noch in den 1950er-Jahren) mit saurem Stoppbad Pinholes riskiert. Ein “pinhole” muss man sich so vorstellen, dass in sauren Stoppbädern entstehende CO2-Bläschen kleine Löcher in die Emulsion reißen. Das ist aber ein historisches Problem, weil die Gelatine nicht gehärtet wurde und extrem empfindlich war. Pinholes sind seit Jahrzehnten kein Thema mehr.
• Runzelkorn entsteht, wenn der Temperaturunterschied aufeinanderfolgender Bäder zu groß ist und dadurch die gesamte Gelatineschicht runzelig wird. Zumindest hat das ein Buchautor vom anderen abgeschrieben. Auch das ist seit Jahrzehnten kein Thema mehr, selbst wenn man diesen Fehler absichtlich erzeugen will.
• Bromidfahnen (engl.: bromide drags) findet man überwiegend bei Standentwicklung. Zuverlässig verhindern kann man das nur durch mehr Bewegung. Es fällt mir sowieso kein einziger Grund ein, der für Standentwicklung spricht. Bei den bewährten →Standard-Kipprhythmen ist dieser Fehler ausgeschlossen.
Dazu folgende triviale Erkärung ohne auf die chemischen Zwischenschritte einzugehen:
Bei der Reaktion des Entwicklers mit den belichteten Silberbromidkristallen entstehen metallisches Silber und Brom.
Dies geschieht vor allem an Stellen starker Schwärzung.
Die resultierenden Bromverbindungen haben eine höhere Dichte als der Entwickler und sinken nach dem
Herausdiffundieren aus der Gelatine der Schwerkraft folgend an der Filmoberfläche langsam nach unten,
wenn man den Entwickler nicht bewegt.
Weil Bromid die Aktivität des Entwicklers hemmt, werden diese Negativstellen etwas schwächer entwickelt.
Im Positiv hat man dann leicht dunkle Streifen unterhalb von hellen Lichtern.
Eine andere Art von Bromidfahne kann auch bei Rotationsentwicklung entstehen.
Wenn die Rotation immer in der gleichen Richtung erfolgt, kann sich - der Filmwicklung folgend -
Bromid an den in der Spirale innenliegenden Windungen konzentrieren und dort die Entwicklung behindern.
Wichtig ist bei Rotationsentwicklung daher ein regelmäßiger Wechsel der Drehrichtung.
• Oft fälschlich als „Bromidfahne“ gedeutet: ein von den Perforationslöchern des KB-Films ausgehendes Streifenmuster.
Bromid scheidet als Ursache aus, da am unbelichteten Rand keine Entwicklung stattfindet und folglich auch kein Bromid entsteht.
Auch diesen Fehler kenne ich nicht aus eigener Erfahrung und kann daher wieder keine eigenen Beispielbilder zeigen.
Als Ursache vermute ich (nur bei Kippentwicklung) eine übermäßige Verwirbelung
des Entwicklers durch die Perforationslöcher hindurch.
Abhilfe aus meinem Verständnis des Entwicklungsprozesses: Besonders wichtig für eine gleichmäßige Entwicklung
ist eine kontinuierliche heftige Bewegung direkt zu Beginn. Die kaum zu beeinflussende Verwirbelung
durch die Perforationslöcher muss also durch eine gleichermaßen starke Verwirbelung
überall auf der Filmoberfläche überlagert werden.
Kodak z.B. empfiehlt als Rhythmus 5 Kipps in 5 Sekunden, das ist eher ein Schütteln als ein gemächliches Kippen.
Auch Ilford empfiehlt zu Beginn 10s Dauer-Kippen, früher waren das sogar einmal 60 Sekunden.
Wichtig ist natürlich auch hier wieder, dass der Entwicklerfüllstand nicht zu knapp bemessen wird.
Weitere mögliche Ursache: In einer Forendiskussion hat ein erfahrener Profi auch einmal eine ungenügende Fixierung mit zu wenig Bewegung genannt.
Falls das zutrifft, hilft es, noch einmal zu fixieren (und zu wässern). Wenn man's nicht übertreibt, kann längeres Fixieren nicht schaden.
• Wolkige hellere Flecken am Rand des Negativs: entstehen wahrscheinlich durch Schaum und Luftblasen,
die am oberen Rand der Filmspirale festhängen und den Austausch mit frischem Entwickler behindern.
Abhilfe: Die Flüssigkeitsmenge in der Entwicklungsdose darf nicht zu knapp bemessen werden,
siehe hierzu die Angaben des Dosenherstellers.
Ilford und Kodak empfehlen zusätzlich, nach jedem Kipp-Intervall die Dose hart auf dem Tisch aufzustoßen,
um Luftblasen zu lösen. Mir macht das zu viel Krach, ich schwenke die Dose nach jedem Kippen,
so wie ein Genießer das mit seinem Cognac-Glas macht.
Die vor allem bei etlichen Filmen aus dem Hause Harman typische Schaumbildung beim Entwickeln hat mich daher noch nie gestört.
• Einzelne kleine schwarze Pünktchen auf dem Negativ: Nach dem Trocknen kann man solche Pünktchen auf der Emulsionsseite sogar mit dem Finger ertasten. Es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um Rostpartikel aus der Wasserleitung, die sich auf der Emulsion festgesetzt haben. Ich habe bisher keinen Weg gefunden, sie von dort weg zu bekommen, ohne noch größeren Schaden anzurichten. Hier hilft nur vorbeugend, am Wasserhahn einen Partikelfilter zu montieren, der solche winzigen Körnchen aus alten Wasserleitungen zurückhält. Paterson hat einen solchen Filter im Programm, aber der passt wohl nur an alt-ehrwürdige englische Wasserhähne, eher nicht an moderne Küchen- oder Badarmaturen.
• Betrifft nur 120er Rollfilme:
a) mehr oder weniger gleichmäßig auf dem Film verteilte Marmorierungsmuster (durch zu warme oder zu feuchte Lagerung?),
b) Der Aufdruck auf dem Rückpapier ist auch leicht auf dem entwickelten Film zu erkennen
(bei einwandfreier Lagerung ein Reklamationsgrund).
Abhilfe: Rollfilme immer kühl und trocken lagern, grundsätzlich erst kurz vor dem Gebrauch aus der Folie auspacken,
in die sie luftdicht eingeschweißt sind, und nach der Belichtung möglichst schnell entwickeln.
Wichtig ist auch, Rollfilme nie auf Vorrat einzukaufen, sondern diese unabhängig vom aufgedruckten
Haltbarkeitsdatum immer möglichst frisch zu verwenden. Probleme macht hier eigentlich nicht der Film, sondern das Rückpapier.
Mit solchen Fehlern kämpfen mittlerweile alle Hersteller von Rollfilmen,
weil für einen Nischenbedarf Rückpapier in der altbewährten Qualität wohl nicht mehr lieferbar ist.
Man könnte jetzt auf die Idee kommen, statt Rollfilm 120 eben den Typ 220 ohne Rückpapier zu konfektionieren.
Ganz so einfach ist das leider nicht, da die schwarze Seite des Rückpapiers einen wichtigen Anteil am Lichthofschutz hat.
Die dafür notwendigen uralten Maschinen und Einrichtungen können heute sicher nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden
oder wurden bereits entsorgt (Ausnahme: Shanghai).
Eine bebilderte Zusammenstellung von typischen Negativfehlern findet man auch bei Ilford (natürlich in Englisch): “Common Processing Problems”
Fragen zu Fotopapier und Positiv
Welches Fotopapier ist zu empfehlen?
Gleich mal vorweg: Meine persönlichen Erfahrungen beschränken sich auf Ilford Multigrade und Agfa/Adox MCP. Letzteres wurde wegen nicht mehr verfügbarer Rohstoffe leider wieder eingestellt. Neben Harman Technology (mit den Marken Ilford und Kentmere) gibt es noch Foma (Tschechien), sowie hier schwer erhältliche Ware von Oriental New Seagull (aus Japan, aber wieder von Harman produziert?), Silverchrome von Ilford Japan (≠ Ilford UK) oder fest graduierte Papiere von Slavich (Russland). Mehr kenne ich nicht. In Europa scheint es demnach leider nur noch zwei Hersteller zu geben. Händler, die unter eigenem Namen vermarkten wie z.B. Adox (D), Bergger (F) oder Fotospeed (GB) sind wohl Kunden bei Harman, deren Beschichtungsanlagen auch im Fremdauftrag laufen. Wann die seit 2011 stillstehende Ilford/Cibachrome-Beschichtungsmaschine im schweizerischen Marly die Serienproduktion von Adox-Papieren aufnehmen wird, ist noch offen. Geplant war mal 2020.
Was man so hört oder liest, scheint es hierzulande kaum schlechte Papiere zu geben. Daher spielt die Marke zunächst eine untergeordnete Rolle. Man muss sich lediglich zwischen unterschiedlichen Technologien entscheiden.
Baryt- oder PE-Papier?
Qualitätsfetischisten schwören auf Baryt-Papiere wegen der optimalen Archivfestigkeit
und der angeblich größeren Brillanz. Der Nachteil von Baryt-Papieren liegt in der
mühsameren Verarbeitung. Wie das geht, hat z.B.
Otto Beyer
beschrieben. Aber wenn ich anderswo lese, welche Probleme man mit der
Trocknung von Baryt-Papieren
haben kann, wirkt das auf mich nur abschreckend!
Für meine Ansprüche reicht die Brillanz von PE-Papieren aus, und meine Bilder müssen auch nicht 150 Jahre alt werden.
Daher meine persönliche Empfehlung für Anfänger:
PE- bzw. RC-Papier mit Kunststoff-versiegelter Papierunterlage,
die sich nicht mit Chemikalien vollsaugen kann. Die Prints baumeln dann
nach kurzer →Wässerung an der Wäscheleine.
Feste Gradationsstufen oder Variokontrast?
Meine Empfehlung lautet ganz klar: Variokontrast oder Multigrade oder wie immer
die Hersteller das nennen. Bei diesen VC-Papieren kann der Kontrast in weiten
Grenzen über die Farbfilterung eingestellt werden. Wie das funktioniert,
habe ich in einem eigenen Kapitel zum →Variokontrastpapier beschrieben.
Der Aufwand der Farbfilterung ist gering, und man benötigt bei optimaler Flexibilität je
Papierformat nur eine einzige Schachtel. Diesen gewaltigen Vorteil muss man sich
möglicherweise mit kleinen Problemen bei der Scharfstellung erkaufen,
siehe dazu meine Ausführung zur →UV-Empfindlichkeit.
VC-Papiere haben sich eindeutig im Markt durchgesetzt. Papiere in festen Gradationsstufen
führen eher ein Nischenleben und werden nur noch in begrenztem Umfang angeboten.
Meine Empfehlung, sich bei Film und Entwickler erstmal auf eine (1!) bewährte Kombination zu konzentrieren, bevor man alles mögliche durchprobiert, gilt erst recht für Fotopapier. Eine neue Papiersorte sauber einzutesten und sich damit intuitive Erfahrung anzueignen, ist viel aufwändiger als bei Film. Eine bestimmte Gradationsnummer ergibt leider nicht bei allen Papiersorten den gleichen Kontrast. Die Gradationsstufen definiert jeder Hersteller von Papier oder Filtersätzen nach eigenem Belieben. Erschwerend kommt noch dazu, dass Papier von einer Fertigungscharge zur nächsten und mit zunehmendem Alter seine Eigenschaften ändern kann. Das gilt übrigens auch für Filme, die aber nicht so punktgenau belichtet werden müssen.
Welchen Entwickler nehme ich für mein Fotopapier?
Bitte nicht auf die Idee kommen, die Papiere in Filmentwickler zu baden, weil man den sowieso gerade da hat. Im Prinzip würde das sogar funktionieren, z.B. mit fett angesetztem Rodinal 1+7, aber das wird erstens teuer und zweitens oxidiert Filmentwickler in der offenen Schale viel zu schnell. Andersrum geht es im Prinzip auch, d.h. man kann Filme in Ilford PQ Universal, Calbe E102 oder Spur UFP baden. Diese Brühen werden als Universalentwickler angeboten, d.h. sie sind auch vorgesehen zur Schalenentwicklung von Planfilmen, und bei diesen haben Schärfe und Feinkörnigkeit eine eher geringe Priorität. Für KB und Rollfilm rate ich davon ab, ohne es jemals ausprobiert zu haben. Ich möchte im Hobbylabor nicht mit wirtschaftlich optimierten Prozessen arbeiten, sondern mein Schwerpunkt liegt eher auf bestmöglicher Qualität der Negative.
Filmentwickler arbeiten stark verdünnt und langsam, und der Entwicklungsprozess wird bei Erreichen des gewünschten Kontrastes (→γ-Wert) vorzeitig und gezielt abgebrochen. Filmentwickler oxidieren bei Kontakt mit Luft auch recht schnell und verlieren ihre Aktivität. Im Gegensatz dazu sind Papierentwickler deutlich robustere Mixturen. Sie sind neben langer Haltbarkeit in der offenen Schale darauf optimiert, in kurzer Zeit eine möglichst hohe Schwärzung zu erreichen, siehe auch hier: →Mindest-Entwicklungszeit für Papier.
Welche Marke man verwendet, ist in erster Näherung egal - jede tut es! Die meisten kommen als Flüssigkonzentrat und werden zum Gebrauch nach Anleitung verdünnt. Als Pulverentwickler ist lediglich Adox „Adotol konstant” wegen der guten Haltbarkeit des Ansatzes und der kurzen Entwicklungszeiten erwähnenswert. Für spezielle Effekte, oder wenn man das allerletzte Quäntchen an Qualität noch herausholen will, gibt es von Moersch-Photochemie neben hervorragenden Standardentwicklern auch die passenden Spezial-Angebote.
Den Papierentwickler kann man nach einem Fotolaborabend wieder in eine Flasche zurück gießen und demnächst weiter verwenden, im Grunde so lange, bis er nicht mehr funktioniert und kein sattes Schwarz mehr liefert. Die Farbe ändert sich bis dahin in pissgelb, und durch Verschleppung in das →Stoppbad wird er immer weniger, sodass man ihn intuitiv eher zu früh ersetzt. Da er nicht viel kostet, ist das auch okay.
Noch ein Tipp: In nur teilweise gefüllten Flaschen wird das Entwicklerkonzentrat durch Luftsauerstoff oxidiert, was man bei den meisten Entwicklern an zunehmender Gelb- bis Braunverfärbung erkennt. Daher empfehle ich, das Konzentrat in kleinere Glasfläschchen umzufüllen (Aponorm-Flaschen aus der Apotheke) und zusätzlich größere Hohlräume mit Schutzgas zu füllen. Das dafür bewährte Tetenal „Protectan“ gibt es nicht mehr, stattdessen kann man ein günstiges Druckluftspray nehmen, wie es für die Reinigung von Tastatur, Computer, Kamera usw. angeboten wird. In diesen Sprühdosen ist üblicherweise keine Luft, sondern ebenso wie in Protectan eine Propan/Butan-Flüssiggasmischung, also Feuerzeuggas.
Und noch ein Tipp: Papierentwickler kann mit zunehmender Ausnutzung und damit
ansteigendem Bromidanteil einen leicht wärmeren Bildton erzeugen.
Durch kontinuierliches Regenerieren erreicht man,
dass z.B. alle Prints für eine größere Serie denselben Farbton haben.
Bei Papierentwicklern funktioniert dieses Regenerieren prima und verursacht keine Mehrkosten.
Wenn der Papierentwickler lt. Strichliste die Hälfte seiner Ausnutzung erreicht hat,
einfach die halbe Menge frischen Entwickler ansetzen, mit dem alten auf
das Nennvolumen auffüllen und den Rest der alten Brühe entsorgen.
Auf diese Weise wird auch kontinuierlich der Entwicklerverlust durch
Verschleppung in das Stoppbad ausgeglichen.
Wer entsprechend hohen Filmdurchsatz hat, sollte für die Negativentwicklung eine ähnliche
Arbeitsweise mit →regeneriertem Xtol in Betracht ziehen.
Wie lange muss Fotopapier entwickelt werden?
Papier wird grundsätzlich ausentwickelt, bis die Maximalschwärze erreicht ist. Auf der Papier- und/oder Entwicklerpackung ist wahrscheinlich eine Zeitempfehlung angegeben, aber wie auch bei Filmen regiert jede Papiersorte und jeder Papierentwickler anders. Bei Ilford Multigrade V RC ist man mit 2:30 Min. auf der sicheren Seite (beim alten MG IV ging's schneller) und bei Baryt-Papieren muss man sich irgendwann entscheiden, bevor der Grauschleier kommt. Diese genannten Zeiten gelten für Standard-Entwickler, die aus Flüssigkonzentrat angesetzt werden (z.B. Adox Neutol NE, Amaloco 6006). Etwas schneller arbeitet dagegen der aus Pulver angerührte „Adotol Konstant“. Man muss das für die eigene Papier-Entwickler-Kombination am besten selbst ausprobieren. Dazu genügen kleine überbelichtete Papierschnipsel, die man auf der Rückseite entsprechend beschriftet und dann 60, 90, 120, … Sekunden lang entwickelt, bei Baryt auch noch länger. Nach dem Trocknen und dem Vergleich unter gutem Licht kennt man die minimale Entwicklungszeit für tiefes Schwarz. Um auf der sicheren Seite zu liegen, falls der Entwickler z.B. im Winter mal etwas kühler ist, noch eine halbe Minute zugeben und gut ist’s. PE-Papier versehentlich mal doppelt so lange im Entwickler zu lassen, wird nicht schaden. Erst wenn man das Papier so richtig quält, kommt ein Grauschleier. Ob diese Grenze überhaupt relevant ist, kann man gleich mittesten, indem die Schnipsel nur auf einer Hälfte belichtet werden. Dann hat man im Idealfall rein-weiß neben tief-schwarz. Baryt-Papier ist sensibler und saugt sich bei zu langer Verweildauer übermäßig mit Chemikalien voll, die man wieder mühsam herauswässern muss.
Wer nicht testen mag: Als grober Anhaltswert für die Entwicklungszeit wird oft die 6-fache Bildspurzeit genannt. Nicht alle Papier-Entwickler-Kombinationen reagieren gleich, aber das sollte auf jeden Fall ausreichen. Bildspurzeit ist die Zeit, nach der sich auf dem Papier in der Entwicklerschale gerade die ersten Schattenkonturen zeigen. Diese Orientierung an der Bildspurzeit berücksichtigt auch alle Einflüsse aus Entwicklertemperatur und aktuellem Ausnutzungsgrad.
Wie lange kann man SW-Papier lagern?
Im Gegensatz zu Film ist auf den Papierschachteln kein Haltbarkeitsdatum aufgedruckt. Aus der Chargennummer kann manchmal das Herstell- oder Verpackungsdatum abgeleitet werden, womit man aber auch nicht viel anfangen kann. Für Papier gilt in verstärktem Maßstab das Gleiche wie bei Film: Kontrast und Empfindlichkeit lassen kontinuierlich nach, der Grundschleier nimmt zu. Und wenn man neben Filmen auch noch die Papiervorräte im Kühlschrank lagern möchte (was gut wäre), braucht man irgendwann einen eigenen Hobby-Kühlschrank oder es gibt Ärger zu Hause. Daher gilt hier meine gleiche dringende Empfehlung wie schon bei Film, Verbrauchsmaterial nicht längere Zeit auf Lager zu legen, sondern bei Bedarf wieder frisch zu bestellen.
Ilford Multigrade IV war nach meiner Erfahrung wenig sensibel und hielt etliche Jahre durch. Ich hatte noch einige Reste von Sonderformaten, die nach 10 Jahren noch einwandfrei waren. Später, nach 15 Jahren Lagerung bei Raumtemperatur mit bis zu 28° im Sommer, habe ich eine Packung normales RC-Papier wegen Grauschleiers entsorgt. Beim Warmton-RC-Papier könnte ein leichter Grauschleier noch als extra-warm durchgehen, aber der Kontrast leidet auch hier darunter. Ich empfehle solche Lagerzeiten nicht zur Nachahmung. Ob das neue Multigrade V, das seit Anfang 2020 das alte MG IV ersetzt, auch so tolerant ist, werden wir erst nach etlichen Jahren wissen. Selbstverständlich ist das nicht. Vor allem beim original Agfa MCP hat man immer wieder gehört, dass es je nach Charge schon nach etwa 2 Jahren Probleme gab (wie üblich Grauschleier und weniger Kontrast).
Ich brauche noch einen Vergrößerer - aber welchen?
Dank Digitalboom kann man gebrauchte Vergrößerungsgeräte heute sehr günstig erwerben, solange nicht der Name Leitz drauf steht. Leider wird der Markt auch überschwemmt von vergammelten Kellerfunden (verstaubter Dachboden ginge ja noch), bei denen die Erben oft irrtümlich glauben, sie könnten da etwas Wertvolles zu Geld machen.
An aktuellen Herstellern gibt es nach meinem Kenntnisstand in Europa nur noch Kaiser und Kienzle und wie man so hört, gibt es bei den beiden auch noch Service. Dunco hat zwar noch eine Homepage, Anfragen bleiben aber ohne Reaktion. Weltweit gibt es noch LPL aus Japan, sowie die Beseler-Geräte aus USA und Lucky-Vergrößerer aus Japan (hergestellt von Fujimoto, vertrieben von Kenko), allesamt aber ohne aktuellen Vertrieb nach Deutschland. LPL und vor allem Kienzle haben den Ruf, sehr robuste Profigeräte zu sein. Bei nicht mehr produzierten (z.B. Dunco, Durst, Leitz, Meopta, Liesegang, ...) oder hierzulande seltenen Marken sollte man unbedingt darauf achten, dass beim Gebrauchtkauf das komplette Zubehör dabei ist, da sich die Suche nach Ersatzteilen und speziellem Zubehör schwierig gestalten kann. Für größere Formate gab es noch die selten anzutreffenden Marken Ahel, DeVere, Homrich, Linhof, Omega, Teufel, sowie den Durst Laborator. Die Aufstellung solcher monströsen Vergrößerer kann aber einen Gebäude-Umbau erfordern!
Herkömmliche Vergrößerer gibt es in zwei prinzipiell unterschiedlichen Bauformen:
a) Kondensorgeräte mit 230V Opallampe und Kondensor (eine dicke schwere Glaslinse) oder gar Doppel-Kondensor sind Überbleibsel aus der Zeit, als man ausschließlich mit fest graduierten SW-Papieren gearbeitet hat. Bei Verwendung mit VC-Papieren muss man Folienfilter zur Gradationssteuerung in eine Filterschublade einlegen, was eine ziemliche Fummelei ist. Die Folienfilter bleichen mit der Zeit aus und man muss alle paar Jahre Ersatz besorgen. Solche Kondensorgeräte arbeiten kontrastreich, mit Doppelkondensor sehr kontrastreich. Die Negative sollten daher auf einen eher kleinen →gamma-Wert von etwa 0,50‑0,55 entwickelt werden. Leider werden auch kleinste Stäubchen oder Kratzer unangenehm deutlich und kontrastreich abgebildet. Für Farbvergrößerungen sind diese Geräte wegen Helligkeits- und damit auch Farbschwankungen der Glühbirne schlecht geeignet.
b) Diffusor- oder Mischboxgeräte mit Halogenlampe, Mischkammer (oft nichts anderes als eine weiße Styroporschachtel) und Farb- oder vorzugsweise VC-Filtermodul wären meine Empfehlung. Diese projizieren das Negativ mit weniger Kontrast, daher werden die Filme auf einen eher hohen →gamma-Wert von etwa 0,65‑0,70 entwickelt. Als angenehmen Nebeneffekt erreichen die Filme dabei auch eine etwas höhere Empfindlichkeit. Die eingebauten dichroitischen Glasfilter können stufenlos eingeschwenkt werden, bleichen nicht aus und halten angeblich ewig. Die Filterwirkung ist genau genommen temperaturabhängig, doch diese Auswirkungen sollten vernachlässigbar sein. Für Farbvergrößerungen müssen diese Geräte mit einem spannungsstabilisierten Netzteil verwendet werden, für SW genügt ein einfaches Netzteil.
c) Es gibt auch noch Zwitterkonstruktionen (z.B. von Kaiser oder Dunco) mit Halogenlampe, Mischkammer und Kondensor. Diese gehören von der Arbeitsweise her zur Gruppe b) und projizieren die Negative mit mittlerem Kontrast. Daher sollten auch die Negative einen mittleren →gamma-Wert von etwa 0,55‑0,65 aufweisen.
Und dann gibt es auch noch einige alte Profi-Geräte mit getrennt geregelten Halogenlampen für grünes und blaues Licht (statt Yellow/Magenta), das in einer Mischkammer zusammengeführt wird, oder die Belichtungen erfolgen nach dem →Splitgrade-Prinzip nacheinander.
Wer etwas mehr Geld investieren kann, sollte einen Blick auf die LED Kaltlichtquellen von Heiland werfen. Es werden für nahezu alle Vergrößerer Umbausätze angeboten. Das LED-Modul ersetzt komplett das alte Beleuchtungsteil samt VC- oder YMC-Filtereinheit. Eine vorhandene Mischbox bleibt meist erhalten. Der große Vorteil ist die geringe Wärmeentwicklung und die Unterstützung durch den Heiland Splitgrade®-Controller.
Die oben genannten gamma-Werte gelten bei Messung mit einem Norm-Densitometer nach ISO 5-2 direkt am Film. Empfehlenswert und einfacher ist die Ersatzmessung mit einem Laborbelichtungsmesser auf dem Grundbrett des Vergrößerers und mit den Testnegativen in der Bildbühne. Diese Messung berücksichtigt die individuelle Kontrastwiedergabe des Vergrößerers. Unabhängig von der Vergrößererbauart sollte dieser gamma-Wert bei etwa 0,55-0,60 liegen, passend für Gradation 2 von Ilford Multigrade V. Bei der Entwicklung der SW-Filme auf einen bestimmten Negativkontrast muss man sich also entscheiden, mit welcher Vergrößerer-Bauart und mit welchem Fotopapier man später arbeiten wird. Man kann sich auch als Kompromiss auf einen mittleren Kontrast einigen. Ilford-Entwicklungszeiten gelten z.B. für einen mittleren gamma-Wert 0,62. Dann ist aber die spätere Laborarbeit mit einem reinen Mischkammer- oder Kondensor-Vergrößerer ebenfalls ein Kompromiss und nicht optimal.
Da man sowieso mit Variokontrast-Papier arbeiten wird, empfiehlt sich gleich die Suche nach einem Vergrößerer mit eingebautem VC-Mischkopf. Damit wird mit einem Drehknopf direkt und stufenlos die gewünschte Gradationsfilterung eingestellt. Ein CMY-Farbmischkopf ist in der Handhabung etwas umständlicher, tut es aber auch. Man hat dann später die Option auf Farbvergrößerungen, falls man dazu mal Lust verspürt. Diese ist bei mir bisher ausgeblieben, da der RA-4 Prozess mit Schalenentwicklung nicht sinnvoll ist. Ich habe keine Durchlauf-Entwicklungsmaschine, daher mache ich Farbe ausschließlich digital. In den Datenblättern der SW-Fotopapiere findet man normalerweise Tabellen, welche Yellow-Magenta-Filterung einer bestimmten Papiergradation entspricht. Diese Angaben taugen nur als ungefähre Anhaltswerte. Jeder Hersteller von Papier, Mischkopf oder Filtern legt die Gradationsstufen etwas anders fest. Leider gibt es hierzu keinen allgemein gültigen Standard. Der im Farbmischkopf vorhandene Cyan-Filter wird für SW-Vergrößerungen nicht gebraucht.
Auch wenn man zunächst ausschließlich mit Kleinbildfilm arbeitet, sollte man den Kauf eines Vergrößerers für Mittelformat 6×6 in Erwägung ziehen. Irgendwann wird der Wunsch danach kommen - versprochen! Spätestens ab 6×9 wird es für ein Universalgerät schon arg groß, schwer und unhandlich. Das gilt nicht nur für den Vergrößerer, sondern auch für die meisten Kameras. Wer also von Kleinbild über Rollfilm bis Großformat alles haben will, braucht dafür auch Platz für mehrere (große!) Vergrößerer.
Welches Vergrößerungsobjektiv brauche ich?
Zum Vergrößern von 6×6 Negativen braucht man ein 80mm-Objektiv oder ein 60er Weitwinkel, mit denen man problemlos auch Kleinbildnegative vergrößern kann. Besser für Kleinbild geeignet ist ein 50mm-Objektiv, weil es stärkere Ausschnittvergrößerungen zulässt und meist auch lichtstärker ist. Standard beim Objektivanschluss für Brennweiten im Bereich 50 bis 105mm ist ein M39-„Leica“-Gewinde. Eine Warnung an Bastler: Dieses Gewinde ist kein metrisches Feingewinde M39×1, sondern ein M39×26tpi (threads per inch)!
Bei den weit verbreiteten Objektiven von Rodenstock und Schneider-Kreuznach gibt es parallel zur Normalausführung auch die „Apo“-Versionen, die für das gesamte sichtbare RGB-Farbspektrum korrigiert sind. Da Schwarzweißpapiere rotes Licht sowieso nicht sehen, sind diese deutlich teureren apochromatisch korrigierten Objektive nur bei Farbvergrößerungen von Vorteil.
An Vergrößerungsobjektiven hatte ich ursprünglich Rodagon 2,8/50 und 4,0/80. Weil ich viel Gutes darüber gelesen hatte, habe ich mir für Mittelformat-Ausschnittvergrößerungen noch das 5,6/60-WA-Componon von Schneider-Kneuznach besorgt und festgestellt, dass dieses absolut offenblend-tauglich ist, was man bei Lichtstärke 5,6 auch gut brauchen kann. Damit ist es meinen Rodagonen haushoch überlegen. Bei offener Blende überstrahlt vor allem mein Rodagon 4/80 dermaßen, dass ich sogar zum Scharfstellen immer um 1 Stufe abblende. Zum Vergrößern gut brauchbar sind beide Rodagone, wenn man 2 Stufen abblendet. Das sollte man ohnehin immer machen. Leichte Fokusfehler oder Ungenauigkeiten bei der parallelen Justierung des Vergrößererkopfes werden so durch größere →Schärfentiefe ausgeglichen.
Aufgrund dieser Erfahrung habe ich von Schneider-Kneuznach noch das Componon-S 2,8/50 und 4/80 zu einem Bruchteil des ehemaligen Neupreises dazugekauft. Die Scharfstellung bei offener Blende gelingt mir damit deutlich besser, und für ausreichend randscharfe Vergrößerungen genügt diesen beiden Exemplaren ein Abblenden um eine Stufe.
Zu Vergrößerungsobjektiven von Meopta, Minolta, Nikon, Vivitar, Leica etc. kann ich leider nichts sagen. Wenn man jedoch einen Bogen um alte 3- und 4-Linser macht, haben alle Vergrößerungs-Objektive eine ausreichende Schärfeleistung. Nur eine Warnung: Alte Rodagone aus den 1970er-Jahren mit Zebra-Fassung neigen zu Problemen bei der Verkittung der Frontlinsen („Delamination“). Da muss man beim Kauf aufpassen.
Brauche ich zum Vergrößerungsgerät einen Scharfsteller?
Es gibt zwei unterschiedliche Bauarten: Solche mit Spiegel und Mattscheibe, auf die man durch eine 4…6-fache Vergrößerungslupe mit beiden Augen draufschauen kann und Kornscharfsteller mit Okular (ohne Mattscheibe). Bei den Kornscharfstellern wird auf ein Luftbild des Filmkorns scharfgestellt. Genauer gesagt fokussiert man sein Auge auf ein Fadenkreuz im Strahlengang und sollte in derselben Fokusebene auch das über den Vergrößerer scharfgestellte Filmkorn sehen.
Einfache Kornscharfsteller (z.B. Kenro Focus Scope = LPL, ähnlich Paterson) funktionieren gut in Bildmitte, der recht teure Peak I aufgrund des großen Spiegels überall. Was ich bei Kornscharfstellern nicht mag ist, dass ich, Auge am Okular, über das Grundbrett gebeugt, mit nach oben ausgestrecktem Arm an der Scharfstellung drehen muss. Eine ergonomische Lösung ist das sicher nicht. Probleme hat man damit auch bei sehr feinkörnigen Filmen (z.B. TMax100, PanF) oder geringen Vergrößerungsmaßstäben unter ca. 7-fach: ohne deutlich sichtbares Korn kann man nicht darauf scharfstellen! Lediglich bei flauen Nebelbildern ohne kontrastreiche Konturen kann ein Kornscharfsteller eindeutig im Vorteil sein.
Achtung: Ich bin nicht der Einzige, der die Kornscharfsteller nicht so recht mag. Auch Thomas Wollstein warnt vor deren Tücken. Das Problem ist, dass Sie zwar mit einem für das menschliche Auge sichtbaren Spektrum (rot-grün-blau) eine perfekte Schärfe einstellen, aber das Fotopapier ein anderes Spektrum sieht (grün-blau-UV), das wahrscheinlich nicht gleichermaßen scharf sein wird.
Seit geraumer Zeit verwende ich erfolgreich einen Magna-Sight mit Mattscheibe und 6-fach Lupe, also eine ähnliche Bauart wie das Kaiser-Teil, nur in besserer Ausführung. Damit ist ganz angenehm zu arbeiten, weil ich mein Auge nicht aufs Okular drücken muss. Voraussetzung ist allerdings, dass das Negativ detailreiche Strukturen aufweist, auf die man fokussieren kann. Mit einem speziellen Testnegativ kann ich damit wunderbar die Justierung der Bildbühne meines Vergrößerers überprüfen, indem ich eine gleichmäßige Schärfe in allen vier Ecken des projizierten Bildes anstrebe.
Ein 30 Jahre altes Kaiser-Ding habe ich auch, halte es wegen der viel zu groben Mattscheibe aber für wertlos. Es sei denn die haben da mittlerweile eine bessere Mattscheibe eingebaut.
Zur Überprüfung meiner Scharfsteller habe ich mit Fokussierung per freiem Auge und mit Leselupe verglichen. D.h. ich suche mir eine kontrastreiche Stelle, drehe 2-3-mal an der Scharfstellung hin und her und einige mich auf eine mittlere Einstellung. Das hat bisher immer mit der Scharfstellung des Magnasight oder des Peak I übereingestimmt. Die Schärfe wird bei offener Blende eingestellt, für die Belichtung wird ohnehin noch abgeblendet, und die →Schärfentiefe in der Größenordnung etlicher Millimeter sorgt für den Rest. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass es bei VC-Papier die bereits erwähnten Fokusprobleme durch →UV-Licht-Anteile geben kann, kommen berechtigte Zweifel an diesem Zubehör auf. Eigentlich braucht man also bei noch guten Augen gar keinen Scharfsteller, trotzdem hat jeder (mindestens) einen. Wichtiger ist z.B. bei meinem Dunco für Kleinbildvergrößerungen ein Feineinstelltrieb für die Scharfstellung am Vergrößererkopf.
Welche Schärfentiefe habe ich beim Vergrößern?
Hier eine Beispielrechnung für mein 50er Vergrößerungsobjektiv bei Blende 5,6 (Componon-S mit tatsächlicher Brennweite 52,8mm lt. Datenblatt). Die Öffnungsweite der Blende hat einen Durchmesser von D = 52,8/5,6 = 9,4 mm. Wenn ich ein Bild aus einem Betrachtungsabstand anschaue, der der Bilddiagonale entspricht, kann das menschliche Auge entlang dieser Bilddiagonale 1500 Punkte auflösen, was etwa einer Winkelauflösung von 2' entspricht. Mehr Schärfe sieht man nicht und braucht man daher nicht. Mit diesem anerkannten Grenzwert werden übrigens auch die Schärfentiefe-Gravuren an den Kameraobjektiven ermittelt. (Tipp: für ausreichend scharfe Ausschnittvergrößerungen muss der Schärfentiefebereich bei der Aufnahme kleiner gewählt werden!) Ein 18×24 Abzug mit Rand hat eine Bilddiagonale von etwa 285 mm. Für einen optimal scharfen Bildeindruck darf der Zerstreuungskreis Z beim Vergrößern also maximal Z = 285/1500 = 0,19 mm betragen. Ohne Ausschnittvergrößerung bei formatfüllender, etwa 7,5-facher Vergrößerung beträgt der Abstand des Papiers von der objektseitigen Hauptebene 450 mm.
Eine Rechnung nach den ausführlichen Linsengleichungen ist sehr mathematisch und wenig anschaulich.
Für den hier wirksamen Abbildungsmaßstab ergibt sich eine nahezu symmetrische
Ausdehnung der Schärfentiefe vor und hinter der exakten Schärfeebene.
Ohne den Einfluss von Beugungseffekten gilt mit vernachlässigbaren
Abweichungen ein stark vereinfachter Ansatz nach dem Strahlensatz:
x/Z = 450/D oder
x = 450×(Z/D) = 9,1 mm
Mit anderen Worten: Ich darf von der idealen Schärfeebene hier um 9,1 mm in beiden Richtungen abweichen. Bei Blende 8 wären das schon 13,0 mm. Längere Brennweiten haben eine geringere Schärfentiefe, z.B. liegt diese Toleranzzone bei meinem 80er Componon-S und Blende 8 bei ±8,4mm (4,5-fache Vergrößerung wieder formatfüllend auf 18×24 mit Rand). Man könnte also problemlos etwa durch einfaches Unterlegen unter den Vergrößerungsrahmen leicht stürzende Linien ausgleichen, ohne den Vergrößererkopf zu schwenken (Stichwort: Scheimpflug) oder sichtbar unscharfe Bereiche zu riskieren! Bei Ausschnittvergrößerungen nimmt die Schärfentiefe zu, bei weiterem Abblenden natürlich auch.
Vor allem bei VC-Papier ist es ein Glück, dass es diese doch ordentliche Schärfentiefe gibt. Durch „longitudinale chromatische Aberration“ wären scharfe Abzüge sonst eher ein nur mühsam beherrschbares Zufallsergebnis, siehe dazu meine Ausführungen zur →UV-Licht-Problematik.
Die dargestellten Rechnereien lassen zwei weitere Folgerungen zu:
• Gelegentlich empfehlen „Spezialisten“, ein Stück Fotopapier unter den Kornscharfsteller zu legen,
um Einstellfehler durch die 0,2mm Papierdicke zu vermeiden. Jetzt wissen wir, dass das nicht nötig ist!
• Ein Negativ, das vergrößert auf 18×24 cm eine ausreichende Schärfe aufweist,
kann auch auf jedes andere Format vergrößert werden, wenn man dieses Bild aus einem üblichen Mindestabstand (= Bilddiagonale) betrachtet.
Welche Dunkelkammerlampe brauche ich?
Es gibt für’s Schwarzweißlabor gelbgrüne, orange oder rote Dunkelkammerlampen. Welche man braucht, hängt von der spektralen Empfindlichkeit des verwendeten Papiers ab. Leider sind in dieser Eigenschaft nur fast, aber nicht wirklich alle gleich.
Grundsätzlich gilt: mit rotem Licht ist man immer auf der sicheren Seite. Gelbgrün war früher mal der Standard für Papier in festen Gradationsstufen, für Variokontrastpapier ist gelbgrün sicher untauglich. Ich arbeite überwiegend mit Ilford Multigrade RC. Dafür kann ich orange oder rot verwenden. Das orange Licht meiner Ilford SL-1 ist super-hell, sodass ich in der Dunkelkammer Zeitung lesen könnte (Orange geht nicht bei Foma VC-Papieren). Zusätzlich habe ich noch zwei rote LED-Clusterlampen mit normaler 230V-Glühbirnenfassung (gab es mal bei Conrad Electronic). Alle meine Lampen strahlen indirekt gegen die weiße Decke. So lässt sich wunderbar arbeiten.
Für den Anfang tut es als provisorische Lösung auch ein LED-Fahrradrücklicht. Im Vergleich zu richtigen Duka-Lampen ist das aber recht funzelig.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, einen Schleiertest zu machen. Vor allem Foma-Papiere sind in dieser Hinsicht sehr sensibel und was man so hört, darf dafür auch Rotlicht nicht allzu hell sein. Ein solcher Test (mit Vorbelichtung!) ist dafür dringend anzuraten! Bei normalen Abzügen ist das Papier etwa 3 Minuten lang ungeschützt der Dunkelkammerbeleuchtung ausgesetzt, und das muss es mindestens aushalten (30-60s für Einlegen und Belichtung, ca. 2 Min. in der Entwicklerschale). Inklusive Nachbelichten und Abwedeln kann das auch mal länger dauern. Das Ganze funktioniert wie folgt:
Schleiertest:
- Dunkelkammerlicht aus, jetzt ist es zappenduster!
- Ein frisches Blatt, das noch nie DuKa-Licht gesehen hat, aus der Packung nehmen, unter den Vergrößerer legen und so vorbelichten, dass es einen hellen Grauton ergeben würde (das muss man vorher an einem Schnipsel ausprobieren). Ohne diese Vorbelichtung ist ein Schleiertest unbrauchbar, und man hat nur Zeit und Papier verschwendet.
- Im Dunkeln einige Münzen auf dieses vorbelichtete Blatt legen, dann erst die typische Dunkelkammerbeleuchtung einschalten und damit mindestens 3 (oder besser gleich 5) Minuten „belichten“.
- Papier normal entwickeln, fixieren, wässern, trocknen.
Im Idealfall ist das Papier durch die Vorbelichtung einheitlich leicht grau und man kann nicht erkennen, wo die Münzen gelegen haben. Wenn sich diese Stellen als hellere Kreise abzeichnen, hat man ein Problem und muss dringend die Dunkelkammerbeleuchtung ändern bzw. reduzieren.
Wie dunkel muss meine Dunkelkammer sein?
Schon ziemlich dunkel, weil das Fotopapier überwiegend auf blaue Lichtanteile anspricht, und die dominieren bei Tageslicht, das durch eventuelle Ritzen durchtritt. Wenn man sein Fotolabor in der Dämmerung oder danach aufbaut, ist eine ausreichende Abdunkelung viel einfacher. Für einen Schnelltest reicht es aus, in der Dunkelkammer einfach alle Lichter auszuschalten. Wenn an Fensterritzen und Türspalten kein Lichteinfall zu sehen ist, ist es auf jeden Fall in Ordnung, und es ist nicht notwendig, auch noch das Schlüsselloch in der Tür abzudecken. Auch kleinere undichte Stellen am eingeschalteten Vergrößerungsgerät sind vernachlässigbar.
Was sich bei mir bewährt hat: Ich habe einige Quadratmeter dünne schwarze Folie geschnorrt, wie sie von Erdbeerbauern zur Beetabdeckung verwendet wird. Diese Folie ist super-lichtdicht. Ich habe sie trotzdem doppelt genommen, nur damit sie mechanisch robuster wird und ich nicht so vorsichtig damit umgehen muss. Die Folie habe ich so zugeschnitten, dass sie etwa 2cm über den Fensterausschnitt hinausragt. Rundherum habe ich sie mit Tesa-Krepp eingefasst. Zur Abdunkelung klebe ich diese Folie nur an den vier Ecken mit kurzen Klebestreifen an den Fensterrahmen. Bei Nichtgebrauch liegt diese Folie zusammengefaltet im Schrank bei dem anderen Laborkram. Bei dickerer Teichfolie aus dem Baumarkt genügt eine einfache Lage, sie lässt sich aber nicht so flexibel zusammenfalten und verstauen.
Tagsüber ist diese Methode leider völlig untauglich und die verbleibenden Ritzen sind viel zu groß. Ab der Dämmerung und danach reicht das aber locker aus. Trotz Straßenlaterne an der gegenüberliegenden Hauswand hat diese Verdunkelung noch jeden Schleiertest überstanden. Bei zweifelhafter Verdunkelung ist ein solcher →Schleiertest dringend anzuraten!
Wie reinige ich den Belag in der Entwicklerschale?
Diese immer wieder gestellte Frage verstehe ich nicht. Es ist wohl typisch deutsch, dass immer alles sauber sein muss. Bitte bedenken Sie, dass durch ständiges Putzen viele Sachen schneller verschleißen und kaputtgehen als durch normalen Gebrauch. Natürlich entsteht im Lauf der Jahre an den Spiralen der Filmentwicklungsdosen und in der Entwicklerschale der Dunkelkammer ein schwarzer Silberniederschlag. Der sitzt aber ziemlich fest. Was bei normalem Spülen mit klarem Wasser und vorsichtigem Gebrauch einer Spülbürste nicht abgeht, darf dranbleiben. Man nennt das Patina, und das zeugt davon, dass dieses Zubehör einem erfahrenen, alten Hasen gehört.
Wer jetzt immer noch meint, er müsste da mal sauber machen: Eine Fotochemikalie, die dafür vorgesehen ist, metallisches Silber in wasserlösliche Silbersalzverbindungen zu überführen, ist das Bleichbad aus dem Farbprozess.
Jetzt im Ernst: Es ist eine anerkannte Erfahrung, dass der Film beim Einspulen leichter
in alte Spiralen reinflutscht als in neuwertige saubere. So soll es doch sein!
Und die Entwicklerschale? In der Dunkelkammer ist es dunkel, da sieht man den
Belag sowieso nicht. Davon abgesehen: Wir kippen schon genug Chemie in den Gully,
da sollten wir nicht auch noch scharfe Reinigungsmittel oder giftiges Bleichbad
hinterherkippen, wenn das nicht unbedingt nötig ist
(siehe dazu auch den Abschnitt zur →Gesundheitsgefährdung).
Was ist bei Ausstellungsbildern zu beachten?
Ich gehe davon aus, dass die Bilder von Hobbyfotografen nicht jahrelang von einer Ausstellung zur nächsten wandern, sondern zu 95% in Pappschachteln dunkel gelagert werden. Wenn man beim →Fixieren und →Wässern nicht übel geschlampt hat, sollten diese Bilder ohne weitere Maßnahmen die erforderlichen Jahrzehnte überdauern. Bei Bildern (egal ob Baryt oder PE), die in irgendwelchen Rahmen längere Zeit dem Tageslicht ausgesetzt sind, gibt es folgende Tipps:
• Obligatorisch für SW-Abzüge an der Wand ist eine Bildsilber-Stabilisierung entweder durch eine abschließende Tonung (Details bei moersch-photochemie) oder noch besser durch ein Schlussbad in Agfa Sistan, das es seit der Agfa-Pleite nicht mehr im Original gibt. Wenn man „sistan“ sucht, findet man aber fast überall ein Ersatz- oder Nachfolgeprodukt, das offensichtlich wegen Markenrechten einen anderen Namen haben muss (z.B. Adox ADOSTAB, Compard AG STAB). Ohne diese Stabilisierung zeigt vor allem Foma PE-Papier an Licht und unter Glas recht schnell Aussilberungen. Eine Nachbehandlung mit Sistan hat den Vorteil, dass sich dabei der Bildton nicht verändert. Nach dem Sistan-Bad kommen die Bilder direkt an die Wäscheleine und dürfen NICHT mehr gewässert werden.
• Mit Sistan kann man übrigens auch Filme für eine Langzeitarchivierung fit machen. Solche Negative kann man dann vererben. Wahrscheinlich können die Erben aber nichts damit anfangen und werden eines Tages die komplette Negativsammlung im Müll entsorgen :-(
• Selen-Toner wirkt vor allem in den Schattenbereichen und verstärkt den Kontrast, was ja auch gewünscht sein kann. Abhängig vom Papier kann Selen jedoch einen leicht rötlichen Aubergine-Stich in den Schwärzen erzeugen.
• Hinsichtlich Haltbarkeit wäre eine Schwefel-Tonung das Optimum. Das Bildsilber wird dabei in stabiles Silbersulfid umgewandelt. Die Schwärzen sind danach schwarz-braun, und der Kontrast wird geringer. Das sieht dann nach einem Bild aus Ur-Opas Zeit aus.
• Bilderrahmen kauft man nicht in Knuts Möbelhaus und auch nicht im 1-Euro-Shop, sondern zusammen mit einem Passepartout aus säurefreiem Karton im Fachhandel, der gratis oder für einen kleinen Aufpreis auch eine fix-und-fertige, staubfreie Rahmung als Dienstleistung anbietet. Im Versand erhält man hochwertige Rahmen und Passepartouts z.B. bei soobsoo, Halbe oder Max Aab.
Wie funktioniert Variokontrastpapier?
Hier ein einfaches Erklärungsmodell, in Wirklichkeit ist’s sicher etwas komplizierter: Variokontrastpapier besteht im Prinzip aus einer Mischung zweier Emulsionen. Jede Emulsion reagiert ohne weitere Maßnahmen überwiegend auf das energiereiche blaue Licht. Die Reaktion einer Emulsion auf andere Lichtfarben wird vor allem durch Behandlung der Kristalle mit bestimmten Farbstoffen gesteuert. Jede der eingesetzten Emulsionen erhält dadurch ihre eigene, gezielt eingestellte Empfindlichkeit für die grünen Lichtanteile (auf blaues Licht reagiert sowieso jede Emulsion gleich). In der nachfolgenden Abbildung sind die Steigungen und Maximaldichten der beiden Emulsionen identisch dargestellt, was nicht notwendig ist, aber die praktische Umsetzung anschaulich wiedergibt. Die Gesamtschwärzung ergibt sich aus der additiven Überlagerung der Dichtekurven.
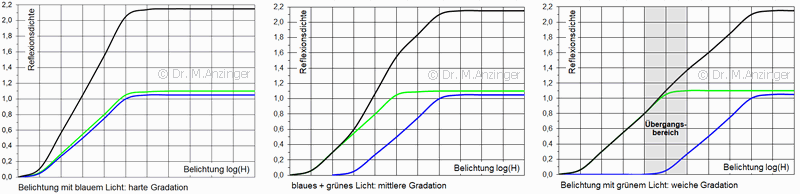
grün= maximal grün-sensibilisierte, blau= weniger grün-empfindliche Emulsion,
schwarze Linie = blau+grün: überlagerte Dichtekurve
Bei blauem Licht reagiert die gesamte Mischung mit gleicher Empfindlichkeit und ergibt dadurch eine schnelle Schwärzung und einen harten Kontrast, siehe das linke Diagramm. Für grünes Licht (rechtes Diagramm) weisen die beiden Emulsionen eine unterschiedliche Lichtempfindlichkeit auf. Zunächst reagiert nur der stärker grün-sensibilisierte Emulsionsanteil, der Rest hat bei dieser Lichtfarbe eine geringere Empfindlichkeit. Der weniger grün-empfindliche Emulsionsanteil trägt daher erst nach einer gewissen Mindestbelichtung zur Gesamtschwärzung bei. Dadurch ergibt sich insgesamt ein weicher Kontrast. Mit blau-grünem Mischlicht kann man jede beliebige Zwischenstufe erreichen (mittleres Diagramm). Wie man auch erkennen kann, wird bei ausreichender Belichtung unabhängig von der Gradationsfilterung immer dieselbe Maximaldichte erreicht. Die Schwierigkeit ist, den Überlappungsbereich dieser Kurven für alle Gradationen so zu gestalten, dass sich immer ein kontinuierlich ansteigender, möglichst linearer Verlauf der Gesamtdichte ergibt. Um diese Ziele optimal anzunähern, besteht Ilford Multigrade aus einer Mischung von drei verschiedenen Emulsionen. Für andere Papiere kenne ich leider keine Informationen der Hersteller. Bei festgraduierten Papieren gibt es dieses Problem natürlich nicht, dafür aber reichlich andere.
Für Interessierte: Nicholas Lindan von Darkroom Automation (amerikanischer Hersteller eines Labor-Belichtungsmessers) hat Überlegungen zu “Variable Contrast Papers and Local Gamma” auf seiner Internetseite (pdf, natürlich in Englisch).
Und wie funktioniert das jetzt im Vergrößerer?
Die Halogenlampe des Vergrößerers strahlt ein weißes Licht aus, das sich aus etwa gleichen Anteilen Rot+Grün+Blau zusammensetzt. Mit einem Magentafilter wird dem weißen Licht die Komplementärfarbe Grün entzogen (Weiß minus Grün = Magenta nach den Regeln der subtraktiven Farbmischung), blaue und rote Lichtanteile gehen ungehindert durch (Blau+Rot = Magenta bei additiver Farbmischung). Alle Emulsionsbestandteile sind für Rot völlig unempfindlich, rotes Licht ist daher unschädlich. Der jetzt noch vorhandene blaue Anteil ergibt wie oben beschrieben einen harten Kontrast.
Mit einem Gelbfilter wird dem weißen Licht nur das komplementäre Blau entzogen, rote und grüne Anteile (=Gelb bei additiver Farbmischung) gehen ungehindert durch. Der grüne (und unschädliche rote) Anteil führt wie oben beschrieben zu einem weichen Kontrast.
Was für die Papierbelichtung gar nicht notwendig ist, ist der rote Lichtanteil, den man auch weglassen könnte. Es gibt einige Vergrößerer, die statt Yellow und Magenta direkt mit grünem und blauem Licht arbeiten. Der große Vorteil des überflüssigen Rotanteils bei der Y-M-Filterung ist das deutlich hellere und für das menschliche Auge besser erkennbare Projektionsbild. Ein im CMY-Farbmischkopf noch zusätzlich vorhandener Cyan-Filter ist für den hier gewünschten Effekt nicht erforderlich und wird bei speziellen VC-Mischköpfen gleich weggelassen. Bei diesen wird mit nur einem Drehknopf gleichzeitig und stufenlos Gelb raus- und Magenta reingeschwenkt.
Schärfeproblem mit VC-Papieren?
Wie schon geschrieben, empfehle ich eindeutig solche VC-Papiere. Ich möchte hier aber einen kleinen Nachteil gegenüber Papier mit fester Gradation nicht verschweigen [Quelle: Ctein (2011), Post Exposure]: Bei harter Gradation mit M-Filterung können VC-Papiere ein Schärfeproblem haben. Für technisch Interessierte habe ich das nachfolgend ausführlich zusammengefasst. Papier in festen Gradationsstufen hat dafür (u.a.) den Nachteil, dass es als Nischenprodukt nur noch in eingeschränkter Auswahl verfügbar ist.
Etliche VC-Papiere (z.B. die von Ilford) weisen eine ausgeprägte Empfindlichkeit
für Wellenlängen im beginnenden UV-Bereich unter 400 nm auf
(siehe die in den Datenblättern abgedruckten Diagramme zur spektralen Empfindlichkeit).
Die Papierhersteller machen das absichtlich,
um mit Y-M-Filterung eine möglichst breite Kontrastspreizung zu erreichen.
Leider ist kein derzeit erhältliches Objektiv für die Kombination aus sichtbarem und UV-Licht korrigiert.
Lt. Rodenstock ist das nicht möglich, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.
Das Problem ist, dass die Schärfeebene der UV-Licht-Anteile um
etliche mm von der Schärfeebene des sichtbaren Lichts abweicht.
Die Techniker nennen das LCA = longitudinale chromatische Aberration.
Wenn wir den Vergrößerer mit sichtbarem Licht (rot+grün+blau) scharf stellen,
nutzen wir nicht den gleichen Teil des Spektrums, den das Fotopapier sieht
(grün+blau+UV). Das Fotopapier überlagert dem gewünschten scharfen Bild aus grün und blau
daher ein unscharfes Bild aus UV-Licht. Vermeiden könnte man das durch:
• VC-Papier, das nicht auf UV reagiert; dies trifft nur annähernd auf
die VC-Papiere von Foma zu, die dafür nicht bei Orange-Licht verarbeitet werden dürfen,
sondern nur bei funzeligem Rotlicht; mit Foma-Papieren ist daher ein bestandener
→Schleiertest absolut notwendig;
• Halogenlampen, die kein UV-Licht abstrahlen (gibt es nicht);
• LED-Flächenleuchten, das Non-plus-ultra, aber nicht ganz billig bei
Heiland electronic;
• oder durch einen 420nm-UV-Sperrfilter im Strahlengang; einige
Farb-Vergrößerer haben solche Filter fest eingebaut. Solche Filter mildern das Problem etwas,
aber beseitigen es nicht vollständig. UV-Filter sperren nicht schlagartig
alle Wellenlängen unter dieser Grenze, sondern haben einen mehr oder weniger großen
Wellenlängenbereich, in dem ihre Wirkung kontinuierlich zunehmend einsetzt.
Bei betroffenen Papieren ist mit den gerade genannten Maßnahmen die ganz harte Gradation 5 möglicherweise nicht mehr erreichbar, eben weil der UV-Anteil fehlt. Weil man Grad.5 sowieso kaum braucht, ist das leicht zu verschmerzen. Nach dem →Eintesten der Papiere sind alle diese Auswirkungen auf Kontrast und Belichtungszeit natürlich korrekt berücksichtigt.
Eigentlich gibt es für dieses physikalische Problem keine wirklich zufriedenstellende Lösung. Aber so schlimm, wie man jetzt befürchten könnte, ist es trotzdem nicht. Vielleicht sind Sie gar nicht betroffen? Machen Sie einen Test: Erstellen Sie eine starke Ausschnittvergrößerung eines Testnegativs oder eines Negativs mit gut fokussierbarem Filmkorn oder feinen Konturen (z.B. Kirchturmuhr), einmal mit Y-Filterung (weich) und einmal mit M-Filterung (hart). Wenn beide Abzüge bei Vergleich mit einer Lupe gleichermaßen scharfe Konturen zeigen, sind Sie fein raus! Das liegt dann an einer glücklichen Kombination Lampe - Filter - Objektiv - Papiersorte. Und selbst wenn Sie betroffen sind: Wie scharf wollen Sie’s haben? Man betrachtet einen Papierabzug nicht mit der Lupe, zählt dort die Linien/mm oder sucht die Körner. Bei normaler Betrachtung hat mir(!) die Schärfe immer noch ausgereicht. Selbstverständlich ist das jetzt keine Entschuldigung für handwerklich schlechte und deshalb unscharfe Bilder!
Gelegentlich liest man, dass moderne Objektive ohnehin kein UV-Licht mehr durchlassen. Für Zooms mit 15 Linsen mag das richtig sein, für meine Vergrößerungsobjektive mit „nur“ 6 Linsen gilt das definitiv nicht. Daher ist der uralte Tipp, bei Aufnahmen im Gebirge einen UV-Sperrfilter zu verwenden, vielleicht gar nicht so verkehrt, zumindest für Schärfefanatiker. Ich habe mit meinem Dunco-Vergrößerer mit VC-Modul inkl. eingebautem IR+UV-Schutzfilter, 50mm Componon-S und Ilford Multigrade IV einmal folgende Versuchsreihe gemacht: maximale Auszugshöhe mit ca. 13-facher Vergrößerung, optimale Scharfstellung auf das Filmkorn bei Blende 2,8 und Y-Filter. Zur Auswertung der Testabzüge habe ich eine gute 8-fach-Lupe verwendet. Die nachfolgenden Ergebnisse sollen das Problem beispielhaft demonstrieren, sie gelten NUR für meine hier beschriebene Konstellation.
Ein Abzug mit reiner Y-Filterung (d.h. ohne blau und UV) bei Offenblende 2,8 war erwartungsgemäß direkt scharf. Ein Abzug mit reiner M-Filterung (d.h. inkl. blau und UV) war leicht unscharf und gelang erst zufriedenstellend, nachdem ich unter den Kornscharfsteller 32mm Papierstapel gelegt hatte. Die für mich sichtbare Schärfeebene liegt also 32mm näher am Objektiv als die Schärfeebene des UV+Blau-Mischlichts, das das Papier sieht! Eigentlich würde das jeder Physiker genau andersherum erwarten. Die Ursache dafür liegt bei der achromatischen Korrektur des Objektivs, das mit einer einfachen Sammellinse aus der Schulphysik wenig gemeinsam hat. Bei der mittleren Gradation 2 muss der Papierstapel nur noch 18mm hoch sein. Der Fokusfehler ist also größer als die Abschätzung der Schärfentiefe für diesen Fall (ca. ±8mm) Ich konnte das kaum glauben und habe die Testreihe bei der folgenden Laborsitzung noch einmal wiederholt - mit dem gleichen Ergebnis! Ein mit Blumendraht zusätzlich in den Strahlengang eingehängter UV-Schutzfilter hat bei Grad.5 etwa 1/4 Blendenstufe mehr Belichtung erfordert, brachte aber keine erkennbare Schärfeverbesserung.
Jetzt die Entwarnung: Die hier besprochene Unschärfe ist wohl auch nicht schlimmer als die eines nicht exakt ausgerichteten Vergrößerers. Für knackscharfe Abzüge müsste man sich um beides kümmern. Es ist gut, das zu wissen. Mit bloßem Auge betrachtet, waren meine Testabzüge nur mühsam in eine eindeutige Schärfereihenfolge einzusortieren. Für die normale Fotolabor-Praxis ist dieser Effekt daher nicht so tragisch wie es scheint, und ich kann diese Ergebnisse eigentlich immer ignorieren. Mir bleibt auch gar nichts Anderes übrig, da es zu viele sich überlagernde Einflüsse gibt. Eine exakte Schärfekorrektur wäre u.a. abhängig vom Vergrößerungsmaßstab, der eingestellten Blende und der Gradationsfilterung.
Von diesem Test unter Extrembedingungen einmal abgesehen: Ich vergrößere keine Testnegative, nutze recht selten eine 13-fache Vergrößerung und blende für mehr →Schärfentiefe mindestens um 2 Stufen ab. Und natürlich habe ich meine Filme so eingetestet, dass ich Gradation 4-5 nicht wirklich brauche (genauso wenig wie Grad.00).
Was ist das Splitgrade-Verfahren?
Bevor Sie hier einsteigen, lesen Sie bitte zuerst das vorherige Kapitel über die grundsätzliche Funktionsweise von →Variokontrastpapier! Dann wissen wir jetzt, dass VC-Papier aus verschiedenen Emulsionen besteht, die mit unterschiedlicher Y-M-Filterung (bzw. mit grünem oder blauem Licht) getrennt auf die Belichtung ansprechen. Über die Filterung ergibt sich eine stufenlos einstellbare Gradation von 00 bis 5.
Bei konventioneller Arbeitsweise wählt man zunächst eine dem Negativkontrast angepasste Gradation. Die Belichtung des Fotopapiers erfolgt mit entsprechend eingestelltem Y-M-Mischlicht in einem Arbeitsgang, d.h. mit Gradationsfilter im Strahlengang, Farb- oder VC-Mischkopf. Der Heiland-Splitgrade®-Controller arbeitet anders: Man fuchtelt mit dem Sensor ein bisschen auf der Grundplatte herum, und der Controller ermittelt dabei die hellste und die dunkelste Stelle. Vollautomatisch gesteuert erfolgt zeitlich nacheinander eine reine Gelb-/Magenta-Doppelbelichtung. Mit einer modernen LED Kaltlichtquelle kann diese Doppelbelichtung direkt mit grün (= gelb minus rot) und blau (= magenta minus rot) erfolgen, weil das Papier rote Lichtanteile ohnehin nicht sieht.
Kurz zusammengefasst: Bei konventioneller Arbeitsweise werden die unterschiedlichen Emulsionsbestandteile mit entsprechendem Mischlicht gleichzeitig belichtet. Beim Splitgrade-Verfahren erfolgen reine Y- und M-Belichtungen getrennt und zeitlich nacheinander. Auf das endgültige Ergebnis hat das auf jeden Fall keinen Einfluss.
Ohne einen modernen →Laborbelichtungsmesser kommt man wohl am einfachsten zu einem guten Abzug, wenn man diese zweifache Belichtung nach dem Splitgrade-Verfahren manuell simuliert. Der Grund für diese Empfehlung ist, dass einem neben der richtigen Belichtungszeit die schwierige Entscheidung für eine genau passende Gradationsnummer erspart bleibt! Natürlich muss man auch beim Splitgrade-Verfahren zwei Entscheidungen treffen: eine Y-Belichtungszeit und eine M-Belichtungszeit. Dafür gibt es aber ein vereinfachtes Verfahren, das keine jahrelange Erfahrung erfordert. Die tatsächlich wirksame Gradation ergibt sich dabei stufenlos.
Manuelles Splitgrade völlig ohne Elektronik geht so:
Man ermittelt auf Probestreifen die Belichtung, bei der sich mit stärkstem Gelbfilter
(extraweich, Grad.00) bildwichtige Lichter gerade vom weißen Untergrund abheben.
Dazu verwendet man zunächst grobe Abstufungen, z.B. mit Faktor 2 bei den Belichtungszeiten.
Nach einer ersten Eingrenzung sollte man genauer in 1/4-Stufen arbeiten.
Da sich die Blende natürlich nicht in 1/4-Stufen verstellen lässt, variiert man die Zeit mit Faktoren gemäß folgender Tabelle:
| Blendenstufen | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/6 | 1/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitfaktor | 1,41 | 1,26 | 1,19 | 1,12 | 1,06 |
Dann ermittelt man die Belichtung, bei der sich mit stärkstem Magentafilter (extrahart, Grad.5) die bildwichtigen Schatten gerade noch vom tiefsten Schwarz unterscheiden. Weil ein harter Abzug eben viel härter bereits auf kleine Belichtungsunterschiede reagiert, muss man eine feinere Abstufung wählen, z.B. 1/12-Stufen oder mindestens 1/6-Stufen mit Belichtungszeiten mal 1,12 oder geteilt durch 1,12. Aus dem kompletten Filtersatz werden nur Filter 00 und 5 benötigt. Die Zeiten für die Gelb- und die Magenta-Belichtung kann man vorab getrennt eintesten, da sie sich bei mittlerem Negativkontrast theoretisch(!) nur wenig gegenseitig beeinflussen. Eine Doppelbelichtung mit diesen so ermittelten Einstellungen sollte also bei Negativen mit mittlerem Kontrast (Grad.≈2) schon fast einen perfekten Abzug ergeben, was in der Praxis nicht ganz zutrifft. Die Y-Belichtung wirkt leider doch ein bisschen auf die Schatten, genauso wie die M-Belichtung auf die Lichter. Da hilft nur, mit Erfahrung einzugreifen. Nach meiner Erfahrung muss man beide Belichtungszeiten reduzieren (Y−40%, M−20%).
Bei in der Tendenz eher harten oder eher weichen Negativen geht es einfacher. Es kommt aber auf die Reihenfolge an:
• Bei Negativen mit geringem Kontrast (erforderliche Gradation 3…5):
zunächst die Magenta-Belichtung für tiefe Schatten ermitteln,
und nach dieser Erstbelichtung die erforderliche Zweitbelichtung
für die Lichter (Yellowfilter Nr.00) wieder mit Probestreifen bestimmen.
Im Vergleich zu einer mittleren Gradation fällt die Y-Belichtung kürzer aus
und beeinflusst die Schatten so gut wie gar nicht mehr.
Für einen ganz harten Abzug (Grad.5) entfällt die Y-Belichtung schließlich komplett.
• Bei Negativen mit hohem Kontrast (erforderliche Grad. 00…1):
genau umgekehrt, d.h. zunächst die Yellow-Belichtung für fast weiße Lichter ermitteln
und nach dieser Erstbelichtung die erforderliche Zweitbelichtung
für die Schatten (Magentafilter Nr.5) mit Probestreifen bestimmen.
Für einen ganz weichen Abzug (Grad.00) entfällt die M-Belichtung komplett.
Ein erforderliches Abwedeln oder Nachbelichten in den Schatten erfolgt ausschließlich mit M-Filter und umgekehrt: Erforderliche Optimierungen der Lichter erfolgen ausschließlich mit Y-Filter.
Alle Grauabstufungen zwischen weiß und schwarz ergeben sich bei diesem Verfahren automatisch. Welcher Gradation das letztendlich entspricht, muss man hier gar nicht wissen.
Kurze Zusammenfassung der verschiedenen Arbeitsweisen:
Vorteile des (manuellen) Splitgrade-Verfahrens:
- wenige kleine Probestreifen (im Idealfall nur zwei), die zur Beurteilung schnell mit dem Fön getrocknet werden und danach in den Müll wandern;
- einfaches Abwedeln und Nachbelichten in Lichtern (Y) oder Schatten (M);
- keine Kalibrierung von Gradationsstufen für das gesamte Filterset.
Vorteile der einmaligen Belichtung mit Mischkopf oder Gradationsfiltern:
- einfacher bei Bildern ohne reines Weiß und dunkles Schwarz;
- direkte Kontrolle der bildwichtigen Mitteltöne;
- einfaches Abwedeln und Nachbelichten in Mitteltönen.
Vorteile eines modernen →Laborbelichtungsmessers:
- Probestreifen nur zum Eintesten neuer Papiersorten oder -chargen;
- bei richtiger →Kalibrierung aller Gradationsstufen (leider nur dann!) hat man einen konkurrenzlos schnellen Positivprozess und so gut wie keinen Ausschuss mehr.
Brauche ich einen Laborbelichtungsmesser?
Tja, das ist eine Frage der persönlichen Arbeitsweise. Auf jeden Fall muss beim Vergrößern die Belichtungszeit deutlich genauer eingestellt werden als bei der Filmbelichtung. Das Fotopapier hat keinen Belichtungsspielraum, sondern Belichtung und Gradationsfilterung müssen auf den Punkt genau sitzen. Um das zu erreichen, gibt es grob eingeteilt drei Möglichkeiten:
a) Man misst überhaupt nicht!
Beim Vergrößern erstellt man nur beliebig wiederholbare Abzüge vom Original-Negativ. Daher ist eine Arbeitsweise, die beim ersten Versuch ein möglichst optimales und vorhersehbares Ergebnis liefert, hier nicht ganz so wichtig. Man kann sich auch jedes Mal durch Ausprobieren mit mehreren Probestreifen ans Optimum herantasten. Dieses Verfahren ist zeitaufwändig, weil jeder Probestreifen entwickelt, fixiert, kurz gewässert und getrocknet werden muss. Vor allem bei Barytpapieren gibt es den “dry down” Effekt, durch den Bilder beim Trocknen nachdunkeln. Eine genaue Beurteilung vor allem der Schattenzeichnung erfolgt dann idealerweise bei gutem Tageslicht, was nicht einfach ist, wenn man in den Abendstunden im Hobbylabor steht. Ohne Laborbelichtungsmesser hat man aber keine andere Wahl. Uwe Pilz hat anschaulich beschrieben, wie diese Probestreifen-Methode in der Praxis funktioniert. Da man auf viel Erfahrung angewiesen ist, taugt diese Methode leider nur für Hardcore-Laboranten, die regelmäßig im Labor stehen und in der Lage sind, ihre langfristig angesammelte Erfahrung in intuitives Gefühl für Belichtungszeit und Filterung umzusetzen. Wer nur alle paar Wochen mal in die Dunkelkammer geht, braucht eine hohe Frustrationsschwelle. Weil die Probestreifen hierbei nicht zu klein sein sollten, braucht man neben viel Zeit auch viel Fotopapier, das danach in den Müll wandert.
Schneller ans Ziel kommt man nach meiner Meinung mit einem manuellen →Splitgrade-Verfahren. Für die im Idealfall nur zwei kleinen Probestreifen gibt es ein einfaches systematisches Verfahren. Auch bei nur gelegentlichen Dunkelkammer-Abenden sollte man damit zurechtkommen.
Egal wie man es dreht, Probestreifen brauchen vor allem viel Zeit. Es hat daher schon seinen Reiz, mit Hilfe eines Laborbelichtungsmessers im Positiv-Prozess ähnlich schnell und zielgenau zu arbeiten, wie man das bei der Filmbelichtung gewohnt ist. Ganz so einfach ist es leider nicht, weil die Belichtung und Filterung von Vergrößerungen auf den Punkt genau sitzen muss. Im Gegensatz zu Film hat Papier keinen Belichtungsspielraum. Um die notwendige Präzision zu erreichen, müssen moderne Laborbelichtungsmesser in einem mühsamen Verfahren genau kalibriert werden. Über Einsparungen beim Papierverbrauch wird sich diese Investition im Laufe der Jahre dennoch amortisieren, sofern eine solche Überlegung bei einem Hobby überhaupt relevant ist.
b) Man setzt moderne Messtechnik ein!
Unter modern verstehe ich so etwas wie den RHD Analyser, meine persönliche Preis-Leistungs-Empfehlung. Da ich leider nicht zu den Spezialisten gehöre, die einem Negativ spontan die zumindest ungefähr richtige Belichtungszeit und Gradation ansehen, komme ich damit wunderbar zurecht. Wenn man einmal verstanden hat, wie dieses Gerät arbeitet, möchte man sich gar nicht mehr vorstellen, wie lange man vorher ohne eine solche Hilfe fummeln musste. Auf jeden Fall muss man das Gerät genau auf seinen individuellen Prozess kalibrieren, das heißt man muss nicht nur seine Filme, sondern auch sein →Papier eintesten. Der Analyser arbeitet mit einer Mess- und Anzeigegenauigkeit von 1/12 Blendenstufe. Weil der visuelle Vergleich der Graustufen mühsam und fehleranfällig ist, empfehle ich dafür noch die zusätzliche Anschaffung eines Reflexions-Densitometers. Damit und mit Excel-Unterstützung ist eine Neu-Kalibrierung bei mir in etwa einer Stunde erledigt und sitzt auf den Punkt genau. Man kann dann sich auf Anhieb über locker 90% wirklich optimale Abzüge freuen. Bei den restlichen 10% weiß man danach entweder, dass man die falschen Punkte angemessen hat (also selbst schuld), oder wo man noch zusätzlich nachbelichten/abwedeln sollte, oder dass das Negativ vermurkst ist und keine weitere Mühe lohnt.
Wer nicht selbst kalibrieren mag, für den gibt es noch das Komfortgerät Heiland Splitgrade®-Controller. Der Hersteller liefert hier per Software-Update die Kalibrierdaten für gängige Papiersorten und Entwickler. Weil die Belichtungs-Hardware auch von Heiland kommt, sollte man hier nach dem Auspacken gleich loslegen können. Da Fotopapier (genauso wie Filme) von einer Fertigungscharge zur nächsten leicht andere Eigenschaften hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass man ganz ohne Anpassung der Heiland-Kalibrierung auskommt.
Der RHD Analyser basiert auf einer einmaligen Belichtung mit Mischkopf oder mit den abgestuften Gradationsfiltern von Ilford. Der Heiland Splitgrade®-Controller arbeitet (wie der Name schon sagt) mit einem automatisierten →Splitgrade-Verfahren. Ein eventuell nötiges Nachbelichten wird von beiden genannten Geräten natürlich unterstützt. Beide Systeme sind ausgereift und empfehlenswert, aber leider nicht zu einem Schnäppchenpreis zu bekommen. Den RHD Analyser gibt es mit deutschsprachigem Service übrigens auch bei Heiland. Andere vergleichbare Lösungen scheint es auf dem Markt nicht zu geben.
c) Man hat zur Messung irgendeinen einfachen Laborbelichtungsmesser!
Darunter verstehe ich so etwas wie die alten Kunze-Geräte (wie etwa MP104, MC505), den Hauck MSA II oder den weit verbreiteten Hauck- bzw. Kaiser-Trialux. Geräte dieser Art sind alle technisch überholt. Eine Mittelwertbildung mehrerer Messungen lt. Anleitung erscheint zunächst sinnvoll. Bei der Papierbelichtung ist aber nicht der Mittelwert relevant, sondern die Extremwerte für Lichter und Schatten. Diese Extremwerte müssen getrennt erfasst werden. Solche aus heutiger Sicht einfachen Geräte merken sich leider nur einen Kalibrierpunkt je Papiersorte und können exakte Werte daher nur für die Gradation liefern, für die man den Indexwert kalibriert hat. Bei abweichenden Gradationen bekommt man nur eine Belichtungszeit etwa in der Nähe eines idealen Abzugs. Wenn man nicht mit den original Ilford-Einlegefiltern arbeitet, können diese Abweichungen durchaus im Bereich ±½ Blende liegen. Für die Belichtung von Filmen wäre diese Toleranz noch in Ordnung, bei Fotopapier muss man dagegen Belichtung und(!) Gradation auf den Punkt genau treffen. Mit solchen einfachen Messgeräten muss man den Rest leider wieder mit Probestreifen erledigen, oder man arbeitet mit einer genau auf das Papier kalibrierten Korrekturtabelle für die verschiedenen Gradationsstufen. Das steht in keiner Anleitung. Als jugendlicher Laboranfänger habe ich lange gebraucht, bis ich das kapiert habe. Einfacher wird die Arbeit z.B. mit dem recht weit verbreiteten Trialux durch das manuelle →Splitgrade-Verfahren (Details siehe dort). Dann genügt die Kalibrierung von lediglich zwei Indexwerten für jeweils max. Y- und M-Filterung. Damit man die Indexwerte nicht ständig verstellen muss, kann man anstelle des zweiten Wertes auch mit einer definiert eingestellten Dichteblende am Vergrößerer arbeiten, falls der diese Möglichkeit bietet. Im Vergleich zum RHD Analyser bleibt das aber fummelig, fehleranfällig und bei weitem nicht so genau.
Folgende Uraltgeräte fallen nicht in die Kategorie „einfacher Laborbelichtungsmesser“, sondern sind für ausreichend genaue Messungen ungeeignet und gehören in den Elektronik-Sondermüll: z.B. Jobo Comparator, Jobotronic, Kaiser Automatic Timer cps, Philips PDT021. Ich kenne außer dem PDT021 keines dieser Geräte persönlich, diese pauschale Einschätzung war aber das Resultat etlicher Diskussionen im alten Phototec-Forum.
Wie kann ich mein Fotopapier eintesten?
Dieser Abschnitt beschreibt am Beispiel des RHD Analysers, wie man einen →Laborbelichtungsmesser auf eine vorliegende Kombination Fotopapier + Papierentwickler eintestet. Die zu bestimmenden Papier-Empfindlichkeiten und tatsächlichen Kontrastumfänge für alle am Filterkopf eingestellten Gradationen werden im Gerät gespeichert, und man hat im Idealfall ein “point-and-shoot”-Schwarzweißlabor. Wer keinen modernen Laborbelichtungsmesser hat, braucht nichts einzutesten. Dann muss man aber bei wirklich jedem einzelnen Bild mit Probestreifen arbeiten, was durchaus eine entspannende, befriedigende Tätigkeit sein kann, die nach meist mehreren Optimierungsschleifen zu einem ebenso perfekten Ergebnis führt.
Vorüberlegungen
Für Film besagt eine bekannte Faustregel: Belichte auf die Schatten und entwickle auf einen Kontrast, damit auch die Lichter passen. Beim Papier ist es im Prinzip genau das Gleiche, nur andersrum: Man muss die Belichtung so hintrimmen, dass die Stellen geringster Schwärzung sich gerade vom Hintergrund abheben. Das heißt: auf die Lichter belichten und die Gradation so wählen, damit auch die Schatten passen.
Die Orientierung an den Lichtern ist deswegen günstiger, weil der Empfindlichkeitsunterschied der verschiedenen Gradationen in den Schatten viel größer ausfallen würde. Man erkennt das an den Dichtekurven z.B. im Multigrade-Datenblatt. Der Empfindlichkeitspunkt von Papieren bei Verwendung von Einlegefiltern liegt bei D=0,6 (zum Vergleich: D=0,1 bei Film). Die Dichte 0,6 müsste demnach bei allen Gradationen mit derselben Belichtung erzeugt werden können. Aber wohl nur wenige Hobbyfotografen haben ein Reflexions-Densitometer und können mit diesem Wert etwas anfangen.
Ein weiterer, ebenso wichtiger Grund für die Kalibrierung auf die Lichter ist, dass das menschliche Auge bereits geringfügig unterschiedliche Dichten im Bereich der Lichter gut wahrnehmen kann. Belichtungsunterschiede von 1/12 Blendenstufe (Schrittweite beim RHD Analyser) sind da im direkten Vergleich sichtbar, je härter die Gradation, um so deutlicher. In den Schattenbereichen dagegen kann das Auge messtechnisch deutliche Dichteunterschiede kaum erkennen.
Diese von mir favorisierte Kalibrierung auf die Lichter ist zumindest bei Vergrößerern mit Einlegefiltern oder VC-Mischkopf die einzig sinnvolle. Man könnte theoretisch die Messung auch umdrehen, den Belichtungsmesser auf die Schatten kalibrieren und die Lichter über die Gradation steuern. Bei Vergrößerern mit YMC-Farbmischkopf scheint zu gelten, dass bei Gradationsänderungen die Schatten etwa gleich dicht bleiben. Dort kann man also eine Kalibrierung auf die Schatten versuchen, falls dies von der Auswertelogik des Laborbelichtungsmessers unterstützt wird. Ansonsten gilt: Egal, wie man misst, ob man die hellste Stelle, die dunkelste Stelle oder einen Mittelwert daraus zugrunde legt: Für die Kalibrierung bei unterschiedlichen Gradationsfilterungen braucht man sowieso Korrekturwerte, entweder als Tabelle auf einem Blatt Papier, das man neben dem Vergrößerer an die Wand pinnt, oder abgespeichert in einem modernen Laborbelichtungsmesser.
Die Kalibrierung beginnt (ohne Negativ und für jede Gradation getrennt) mit der Ermittlung einer Belichtungszeit, bei der sich auf dem Abzug ein leichtes Grau ergibt, das sich so eben vom unbelichteten Papierhintergrund abhebt (nach Norm-Empfehlung: Dichte 0,04). Mein RHD Analyser hat hierzu einen bequemen Probestreifen-Modus. Diese Belichtung ist jetzt die Basis für die Empfindlichkeitseinstellung des Laborbelichtungsmessers. Wahrscheinlich ergibt sich für jede Gradation eine mehr oder weniger abweichende Empfindlichkeit. Die Messung mit dem Sensor erfolgt dabei grundsätzlich ohne Filter, erst zur Belichtung wird der Gradationsfilter eingelegt bzw. reingedreht. Für diese Probebelichtungen verwende ich kleine Papierstreifen 4,5×12cm, zugeschnitten aus einem Bogen 18×24. Der Papierverbrauch ist damit minimal.
Erst jetzt folgt in einem zweiten Schritt die Kalibrierung des Kontrastumfangs, wieder getrennt für jede Gradation. Am besten und schnellsten geht das mit einem guten gekauften Graustufen-Negativ oder Graustufenkeil, z.B. von Stouffer oder Danes. Die Belichtung eines →Kontaktabzugs unter dem Lichtstrahl des Vergrößerers enthält leider nicht den →Callier-Effekt, d.h. die durchaus gravierenden Einflüsse des Beleuchtungssystems (Kondensor oder Mischkammer) auf den Kontrast. Ich empfehle daher dringend(!) die normale Vergrößerung des Graustufen-Negativs. Bitte zögern Sie nicht, den Graustufenkeil zu zerschneiden und wieder vorsichtig so zusammenzumontieren, damit er in die Bildbühne des Vergrößerers passt. Wichtig ist auch, dass zur Vermeidung von Streulicht die transparenten Bereiche des Negativs mit einer Maske abgedeckt werden. Die Belichtungsmessung erfolgt mit der im vorangegangenen Schritt ermittelten Empfindlichkeitseinstellung auf das dunkelste Graustufenfeld, also auf die Lichter. Weil Kontraste bei nassen Oberflächen schlecht beurteilt werden können, erfolgt die Begutachtung der Probeabzüge erst nach dem Trocknen unter ordentlichem Licht, idealerweise bei Tageslicht. Welchen Kontrastumfang der Abzug hat, erkennt man durch Abzählen der Graustufen vom ersten leicht angegrauten Feld (Dichte DT=0,04), auf das gemessen wurde, bis zum dunkelsten Feld, das sich noch erkennbar von maximaler Schwärze abhebt (genau: Dichte DS = 90% der Maximaldichte). Diese Eckwerte DT (wie “toe”) und DS (wie “shoulder”) sind in ISO 6846 festgelegt.
Üblicherweise haben die Graustufenkeile eine Dichteabstufung von 0,15 (= ½ Blendenstufe in logarithmischem Maßstab). Wenn man z.B. genau 7 Felder abzählt, ergibt das einen Dichteumfang von 7×0,15=1,05. Dieser Dichteumfang mal 100 entspricht dem ISO-R-Wert aus dem Datenblatt des Fotopapiers. Ob der Stufensprung 0,15 des verwendeten Stufenkeils tatsächlich zutrifft, sollte man durch Messung mit dem Laborbelichtungsmesser überprüfen und anstelle eines konstanten Faktors die gemessenen Dichtewerte verwenden.
Damit ist das Eintesten erledigt, und man hat alle sieben Gradationseinstellungen 00 bis 5 des verwendeten Fotopapiers in Kombination mit dem verwendeten Entwickler die echte Empfindlichkeit und den dazugehörigen tatsächlichen Dichteumfang. Beides kann von den Nennwerten der Datenblätter deutlich abweichen.
Man hat jetzt das Problem, dass in den Laborbelichtungsmesser für jede Papier-Entwickler-Kombination sieben unterschiedliche Empfindlichkeitswerte samt dazugehörigem Dichteumfang eingespeichert werden müssen. Wer einen RHD Analyser hat, ist jetzt wieder fein raus, der schafft das für 8 Papiersorten und interpoliert halbe Gradationsschritte automatisch. Viele ältere Belichtungsmesser können sich leider nur einen Wert merken. Da bleibt also nichts anderes übrig, als mit einer Korrekturtabelle zu arbeiten, nach der man die gemessene Zeit korrigiert, oder nach der man die Lichtmenge mit der Dichteblende am Vergrößerer anpasst. Die Raststufen des Vergrößerungsobjektivs sind für solche Feinkorrekturen viel zu grob.
Nach dieser mühseligen Testerei mit Graustufenvergleichen wird es Zeit, einen richtigen Abzug zu machen, idealerweise von einem Negativ, das sowohl Lichter als auch Schatten mit noch sichtbaren Strukturen aufweist, z.B. ein Porträt mit weißem Hemd und dunklem Strickpulli. Mit einem solchen Motiv erhält man nebenbei auch einen Zielwert für einen schönen Hautton. Das Negativ wird an den hellsten und dunkelsten Stellen gemessen, die jeweils noch Struktur aufweisen sollen. Die dunkelste Stelle ergibt die Belichtung (für Papierdichte D=0,04), die hellste Stelle bestimmt die erforderliche Gradation (für 0,9×Dmax). Der Abzug wird nach dem Trocknen bei gutem Licht beurteilt und mit den Graustufenbildern verglichen. Beim RHD Analyser wird für diesen Zweck ein Stück Fotopapier mitgeliefert, das genaue Vergleichsfelder mit den Dichten 0,04 und 90% Dmax enthält. Nach den ersten Testprints muss man die Kalibrierung oft noch geringfügig anpassen, und fertig ist das “point and shoot”-Schwarzweißlabor.
Ein →Reflexions-Densitometer ist bei der Auswertung der Graustufenabzüge eine große Hilfe,
auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Damit entfallen die fehleranfälligen visuellen Vergleiche mit dem Testmuster.
Mit Auswertung in Excel ist eine komplette Neukalibrierung der sieben Gradationsfilterungen von 00 bis 5 in 1-2 Stunden erledigt,
selten notwendige kleinere Anpassungen in wenigen Minuten. Das sieht dann wie folgt aus.
Papier: Ilford Multigrade V RC
Entwickler: Adox Adotol konstant
Filter: Dunco VC-Kopf
Die Kurven für eine andere Papiersorte oder einen anderen Entwickler können im Detail anders aussehen
und erfordern nach einem Wechsel auf jeden Fall eine erneute Eintestprozedur.
Daher gilt hier genauso wie bei Film und Filmentwickler, eine eingetestete und bewährte Kombination nicht ohne Not zu ändern.
Auch Bauart des Vergrößerers und Filtersatz bzw. Filterkopf zeigen hier deutlich ihren Einfluss.
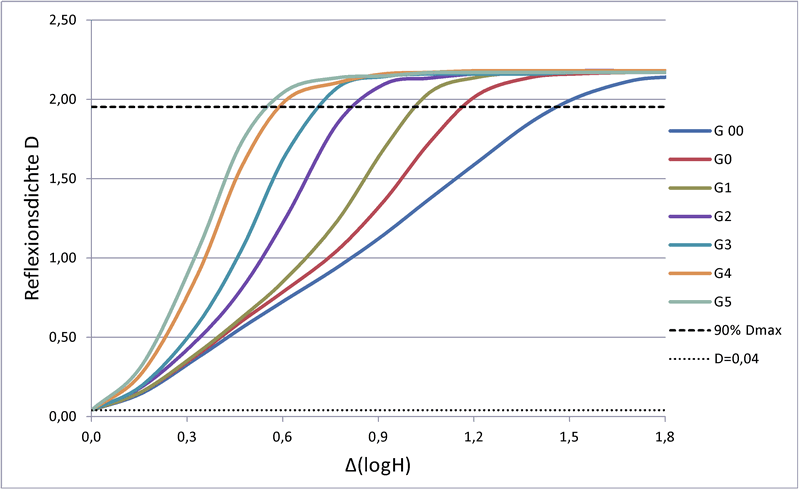
Nach 25 Jahren Multigrade IV ist das hier die fünfte Generation. Die Kurven sehen schon ganz gut aus, deutlich glatter als bei der alten Version. Ein Kurvenverlauf wie mit dem Lineal gezogen ist wahrscheinlich auch nicht optimal. Es könnte daher Absicht sein, dass die Lichter etwas weicher und die Schatten etwas härter wiedergegeben werden, um dem menschlichen Sehvermögen hier ein bisschen nachzuhelfen. Gradationen 00 bis 1 sind in der Wedergabe der Lichter fast identisch und unterscheiden sich vor allem in der Schattenzeichnung. Der geringe Unterschied zwischen 4 und 5 ist wohl auf einen etwas schwachen Magentafilter in meinem Dunco-VC-Kopf zurückzuführen. Diese Tendenz ist jedoch auch in den von Ilford veröffentlichten Kurven zu sehen. Gradation 5 habe ich ohnehin noch nie gebraucht, weil ein solcher Film mit viel zu kurzer Entwicklungszeit gründlich vermurkst gewesen wäre. Der nicht konstante Abstand der Linien ist keine typische Eigenschaft von Multigrade, sondern ist auf die Gradationsskala am Dunco VC-Kopf zurückzuführen, die eben nicht optimal zu Multigrade V passt. Mit den original Ilford-Einlegefiltern könnte das vielleicht besser aussehen. Mit richtig kalibriertem RHD Analyser ändert das aber nichts am Ergebnis.
Ich habe auch noch das preislich interessante Fotoimpex Easy Print RC getestet, von dem Gerüchte sagen, es wäre identisch mit dem Kentmere Papier von Harman. Nach meinen Messungen verhält sich die Emulsion völlig anders als es das Original Kentmere Datenblatt erwarten lässt. Das Papier selbst scheint das gleiche wie bei Multigrade RC zu sein. Aber der höchste Kontrast, den die Easy Print Emulsion mit voller Magenta Filterung bringt, entspricht bei Multigrade der Gradation 2. Man muss für das Easy Print Papier seine Filme also auf einen hohen Kontrast entwickeln, um die Gradationsspreizung nutzen zu können.
Fragen, die Film und Papier betreffen
Wie genau muss ich die Entwicklertemperatur einhalten?
Bei der Entwicklung von Papier ist das kein Thema. Wenn man nicht gerade mit Wintermantel und Pudelmütze in der kältesten Kellerecke arbeitet, dürfte die Dunkelkammer immer eine übliche Raumtemperatur haben und das reicht. Bei höherer Temperatur im Sommer geht es eben etwas schneller. Eine genaue Einhaltung von Zeit und Temperatur ist bei Papier ziemlich egal, da es immer(!) vollständig ausentwickelt wird. Im Zweifelsfall kann man die Zeiten →im Entwickler und →im Fixierbad verlängern, nur zu kurz wäre nicht gut. Schalenthermometer im SW-Labor sind also überflüssig!
Bei Film sieht das anders aus. Der Grad der Entwicklung hängt dort von der Aktivität des Entwicklers, der Zeit, dem Bewegungsrhythmus und eben der Temperatur ab. Ein Grad Temperaturänderung hat bereits Auswirkungen, die einer Zeitänderung von etwa 10% entsprechen, und das sieht man dem Film an. Bei einem Thermometer mit Grad-Skala kann man maximal noch halbe Grad abschätzen und das auch nur, wenn man ihm Zeit lässt. Wenn man sich jetzt die Mühe macht, seine →Film-Entwickler-Kombinationen genau einzutesten und auf einen definierten →gamma-Wert zu entwickeln, ist ein solches einfaches Thermometer zu ungenau.
Das Problem ist die absolute Messgenauigkeit. Wenn ein einfaches Thermometer 20°C anzeigt, weiß man nie, ob das in Wirklichkeit 18 oder 22° sind. Auch relativ teure Thermometer mit 0,2° Skalenteilung für Farbprozesse sind nicht zwangsläufig besser, da auch diese nicht individuell kalibriert werden. Das ist alles noch kein Problem, wenn man immer dasselbe Thermometer nimmt und seine Prozesse damit sauber eintestet. Ein Problem bekommt man erst dann, wenn es einmal runterfällt und ersetzt werden muss. Alle mühsam eingetesteten Entwicklungszeiten müssen mit dem neuen Thermometer überprüft werden.
Besser geht es so (veraltete Methode): Man besorgt gleich 2 gute(!) Thermometer und notiert sich Vergleichsmessungen im relevanten Bereich von 18-24°C. Dass beide innerhalb ihrer Ablesegenauigkeit die gleiche Temperatur anzeigen, wäre ein glücklicher Zufall. Eines der beiden wird als Referenz sorgfältig aufbewahrt, das andere wird benutzt. Ein eventuelles Ersatzthermometer kann man dann mit der Referenz überprüfen und eine Korrekturtabelle erstellen.
Noch viel besser (mein Vorschlag): Man verwendet ein elektronisches Thermometer, das nicht nur Zehntel Grad anzeigt, sondern auch entsprechend genau kalibriert ist. Letzteres ist bei Thermometern für den Schweinebraten und Schnäppchen aus den Elektronik-Wühltischen sicher nicht der Fall (Genauigkeit lt. Datenblatt eines teuren Bratenthermometers von einem Edelhersteller: ±2°)! Ein gutes elektronisches Thermometer hat außerdem den bequemen Vorteil einer sehr schnell reagierenden und gut lesbaren Anzeige. Weil es innerhalb der im Datenblatt angegebenen Genauigkeit und Wiederholbarkeit absolut genau anzeigt, braucht man kein Referenzthermometer als Reserve. Ich empfehle daher eindeutig ein hochwertiges elektronisches Thermometer. Im Fotohandel gebräuchlich ist z.B. das ab Werk individuell kalibrierte Greisinger GTH175PT oder vergleichbare Typen. (ohne Schnickschnack, kein Speicher, kein Microprozessor, einfach einschalten und es zeigt die Temperatur an). Zwei höherwertige konventionelle Thermometer sind in der Anschaffung sogar teurer.
Die Temperatur genau und reproduzierbar zu messen, ist leider nicht immer ausreichend. Die Temperatur muss während der Entwicklungszeit auch noch konstant eingehalten werden. Bei sommerlichen Temperaturen ist das gar nicht so einfach. Z.B. steigt bei 27° Raumtemperatur innerhalb 12 Minuten Entwicklungszeit die Entwicklertemperatur von 20° auf 22° an, die über die Zeit gemittelte Temperatur beträgt 21,5°C. Daher müsste bei diesem Beispiel zur Kompensation die Zeit auf etwa 10,5 Minuten gekürzt werden - oder man füllt den Entwickler mit einer Temperatur von 18° ein und kommt damit auf eine gemittelte Temperatur von 20° ohne Zeitkorrektur. Da der Temperaturausgleich und die Auswirkung auf die Entwickleraktivität nicht linear erfolgen, gelten die Zahlenwerte nur für das genannte Beispiel!
Ich habe da mal ein paar Messreihen gemacht und ein bisschen mit Wärmekapazität, Wärmeleitung und Wärmeübergang herumgerechnet. Seitdem macht diese Korrekturrechnungen jetzt mein 35 Jahre alter Sharp PC-1500 Pocketcomputer, der immer piepst, wenn ich kippen oder auskippen muss. Alternativ kann man im Hochsommer die Filmentwicklungsdose auch in ein 20°-Wasserbad stellen und auf diese Weise die Temperatur ungefähr konstant halten. Immer daran denken: Eine Temperaturabweichung um 1°C sieht man dem Film am Kontrast (→gamma-Wert) an! 1°C müsste mit etwa 10% Zeitänderung kompensiert werden, und das ist nicht vernachlässigbar.
Welches Fixierbad brauche ich für Film oder Papier?
Was ich generell nicht mehr empfehle, sind die alten Pulverfixierer auf Basis von Natriumthiosulfat, das recht langsam arbeitet. Heute üblich sind saure (und leicht sauer riechende), neutrale oder alkalische (geruchsfreie) Expressfixierbäder als bequeme Konzentrate mit Ammoniumthiosulfat als aktiver Substanz. Nur bei Kombination mit bestimmten Filmentwicklern (Pyro-Varianten und Moersch Tanol) sollte man die sauren Fixierer vermeiden, sonst gilt: Egal - jedes Fixierbad tut es sowohl für Film als auch Papier, auch das Fixierbad für den C41 Farbnegativprozess (Achtung: nicht das Tetenal-Bleichfixierbad!). Dieses alkalische C41-Fix funktioniert uneingeschränkt bei allen SW-Materialien, bei Barytpapieren erleichtert es sogar das mühsame anschließende Wässern. Im gewerblichen Handel ist das C41-Fix richtig günstig. Umgekehrt kann man nicht mit jedem SW-Fixierbad C41-Filme fixieren, weil Säure die eingelagerten Farbstoffe angreift.
Wichtig ist, dass für Film und Papier getrennte Lösungen angesetzt werden. Dafür gibt es mehrere Gründe:
- Film enthält nicht nur eine deutlich höhere Konzentration an Silberbromid als Papier, sondern auch eine Reihe anderer Chemikalien, insbesondere Silberiodid, das den Fixierprozess vor allem bei →Flachkristallfilmen stark behindert. Dazu kommen noch lösliche Sensibilisierungsfarbstoffe und Lichthofschutzschichten. All das möchte man nach dem Fixieren von Papier nicht im Papierfilz haben, um die Archivfestigkeit nicht aufs Spiel zu setzen.
- Beim Fixieren von Papieren in der offenen Schale können Hausstaub und Papierfasern in den Fixierer gelangen, und dieses Zeug möchte man sicher nicht auf dem nächsten Film kleben haben.
- Für Filme (1+4) und Papiere (1+7 … 1+9) sind unterschiedlich konzentrierte Ansätze zu empfehlen.
Auch die Überwachung des Ausnutzungsgrades ist bei getrennten Lösungen kein Problem. Am besten macht man für jeden Fixierbadansatz eine Strichliste und ersetzt das gebrauchte Fixierbad lieber zu früh als zu spät durch frisches. Bei Filmen mache ich z.B. für einen konventionellen Film einen Strich, für einen Flachkristallfilm 2 Striche. Was maximal geht, steht auf dem Fixierbadetikett. Ich empfehle nur eine Ausnutzung bis zu etwa 2/3 der Angaben aus dem Datenblatt. Wer es ganz genau wissen will, ob das Fixierbad noch taugt, dem empfehle ich einen einfachen Test mit einem Tropfen Selentoner auf dem weißen Papierrand. Wenn sich dort eine graue bis rötliche Verfärbung zeigt, ist noch Restsilber vorhanden. Dieser Test ist sensibler als die oft empfohlene “Kodak Fixer Test Solution FT-1”. Dieses Originalrezept ist auf den wenigen verbliebenen Kodak-Seiten leider nicht mehr zu finden, eine modifizierte Anleitung dafür gibt es bei Stefan Heymann.
In welcher Verdünnung man die Fixierbäder ansetzen sollte, schreibt kein Hersteller genau vor. Spezialisten empfehlen für die Filmfixierung einen eher fetten Ansatz (1+4), vor allem beim Fixieren von Flachkristallfilmen. Ich habe jahrelang für Film und Papier den sparsamen Kompromiss 1+7 verwendet und hatte damit erstmals Probleme mit einem Kodak TriX, bei dem sich ein wolkiger rosa Grundschleier erst in Fixierbadverdünnung 1+4 aufgelöst hat. (TriX ist kein Flachkristallfilm, aber seit der Umformulierung 2007 werden für diesen Film auch die Sensibilisierungsfarbstoffe der Tmax-Filme verwendet.) Seitdem nehme ich bei Filmen grundsätzlich immer diesen fetten Ansatz. Zur leichteren Auflösung dieser Färbung gibt es optional von Kodak ein angeblich spezielles TMax-Fixierbad. Diese rosa Färbung ist typisch für Kodak-Filme und sollte auch mit jedem anderen Fixierbad spätestens nach der Wässerung verschwunden sein. Wenn das nicht vollständig gelingt, ist das normalerweise ein Indiz dafür, dass das Fixierbad neu angesetzt werden sollte. Die rosa Farbe an sich ist nichts Schlimmes, sie verschwindet angeblich mit UV-Licht, wenn man die trockenen Filme einige Stunden ans Fenster hängt.
Wie lange muss ich / darf ich fixieren?
Bei Filmen gibt es eine klare Regel für die Mindestfixierzeit:
Doppelte Klärzeit für konventionelle Filme, dreifache Klärzeit für →Flachkristallfilme.
Etwas länger kann nie schaden, wenn man es nicht maßlos übertreibt.
Zur Bestimmung der Klärzeit wirft man ein Schnipsel unentwickelten Film (z.B. die sowieso abgeschnittene Zunge des KB-Films) in einen fetten 1+4 Fixierbadansatz und misst die Zeit bis er gerade klar ist. Genauer funktioniert dieser alte Trick: Mit der Fingerspitze einen Tropfen Fixierer auf die abgeschnittene Filmlasche geben, nach etwa 30s diese Lasche ganz ins Fix eintauchen. Klärzeit ist die Zeit, ab der die Grenze nicht mehr sichtbar ist. →Flachkristaller brauchen hierzu deutlich länger. Ein FP4 ist bei mir nach 30s klar, der Flachkristallfilm Delta400 braucht mit 140s (=2:20) am längsten. Für den Delta400 liegt die notwendige Fixierzeit damit bei 2:20×3 = 7 Minuten! Der fette 1+4 Ansatz für Filme fixiert übrigens nicht nur schneller, sondern vor allem sicherer! Die Anzahl der Filme kann man damit erhöhen, die Kosten sind also nicht höher als beim Sparansatz 1+7 oder gar 1+9!
Bei Papier kann man die Klärzeit nicht so einfach feststellen. Die Herstellerempfehlungen liegen hoffentlich auf der sicheren Seite, und es sollte damit keine Probleme geben, wenn man es mit den persönlichen Anforderungen an die Archivierbarkeit nicht übertreibt. Weil Fixierbad nicht teuer ist, empfehle ich für Hobbylaboranten, die Ergiebigkeit lt. Datenblatt nicht voll auszureizen, und im Zweifelsfall lieber früher neu anzusetzen. Ob das Papier ausreichend ausfixiert ist, kann man nach Fixieren und Wässern leicht mit einem Tropfen Selen-Toner auf dem unbelichteten, weißen Papierrand feststellen. Wenn nach unvollständiger Fixierung oder Wässerung dort noch Silberreste vorhanden sind, ergibt das einen grauen, oft leicht rötlichen Fleck. (Den Tropfen Selen-Toner aber bitte nicht mit der Fingerspitze auftragen, sondern eine Pipette oder ähnliches benutzen.)
Ein definierter und immer genau eingehaltener Kipp- oder Bewegungsrhythmus ist beim Fixieren nicht so extrem wichtig. Weil Bewegung nicht schaden kann, erfolgt bei mir das Kippen der Film-Entwicklungsdose „frei Schnauze“ circa 1-2 mal je Minute. Papiere in der Fixiererschale werden mit der Zange gelegentlich wieder untergetaucht, damit sie immer vollständig benetzt sind.
Wie lange darf man fixieren?
Viele Fixierbäder enthalten als Desoxidationsmittel Kaliumdisulfit oder Natriumsulfit.
Vor allem das letztere wirkt auf die schon entwickelten Silberkörner leicht ätzend und löst diese wieder an
(Funktionsprinzip vieler Feinkornentwickler).
Damit dieser Effekt sichtbar wird, muss man es aber ordentlich übertreiben.
Wenn man die Fixierzeit nicht gleich auf eine halbe Stunde ausdehnt,
ist ein bisschen länger auf keinen Fall schädlich. Bei Film oder PE-Papier ist man damit sogar
auf der sicheren Seite und erreicht auch mit weniger Bewegung ein vollständiges Ausfixieren.
Bei Barytpapieren gelten andere Regeln: Der Papierfilz saugt sich übermäßig mit Fixierer voll
und erschwert dadurch den ohnehin schon mühsamen nachfolgenden Wässerungsprozess.
Eine gute Idee ist auf jeden Fall die Zweibad-Fixierung: Man fixiert nacheinander in zwei gleichartigen Fixierbädern. Wenn das zweite Bad lt. Strichliste verbraucht ist, wird es als Bad 1 weiter verwendet und Bad 2 wird frisch angesetzt, usw. Damit kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, und das ohne Mehrkosten. Dafür braucht man lediglich im Labor Platz für eine 4. Schale (Entwickler - Stoppbad - Fix1 - Fix2). Was dabei abläuft, hat Thomas Wollstein gut beschrieben (Vorsicht: Chemie!). Eine wichtige Regel aus Wollsteins Ausführungen: Eine zunehmende Ausnutzung des Fixierbads kann nicht durch eine verlängerte Fixierzeit kompensiert werden!
Ist ein Stoppbad notwendig?
Bei der Filmverarbeitung ist ein genau definiertes Ende der Entwicklungszeit wichtig für ein reproduzierbares, konstantes Ergebnis. Irgendwie muss der Entwicklungsprozess, der grundsätzlich eine alkalische Umgebung (pH-Wert > 7) benötigt, möglichst schnell unterbrochen werden. Dazu gibt es prinzipiell 3 Methoden:
- Eine Zwischenspülung mit Wasser verdünnt die Entwicklersubstanz bis zur Unwirksamkeit und senkt ebenfalls durch den Verdünnungseffekt den pH-Wert ab, damit der Entwickler nicht mehr arbeiten kann.
- Ein saures Zwischenbad wirkt erstmal auch verdünnend, aber zusätzlich noch stark beschleunigt durch die aktive Neutralisation des basischen Milieus. Für eine optimale Reproduzierbarkeit beim →Eintesten des Entwicklungsprozesses ist das die empfohlene Methode.
- Ein gepuffertes leicht alkalisches Zwischenbad kann bei stark alkalischen Entwicklern (z.B. PMK) ebenfalls aktiv und schnell den pH-Wert bis zur Unwirksamkeit der Entwicklersubstanz senken, ohne gleichzeitig durch Säure den entstandenen “stain” anzugreifen. Wasser tut's aber auch, daher halte ich das für einen von Chemie-Freaks erdachten Overkill.
Der Standard für’s SW-Labor ist ein saures (und leicht sauer riechendes) Fixierbad. Nach Meinung vieler Fotolaboranten ist bei sauren Fixierbädern eine Zwischenwässerung nach der Filmentwicklung ausreichend. Neutrale oder alkalische (geruchlose) Fixierbäder erledigen den Fixierprozess gleichermaßen gut. Die Empfehlungen für ein Stoppbad sind dafür aber nicht einheitlich.
Meine Empfehlung (und die von Ilford) ist, für normale SW-Filme und Entwickler grundsätzlich ein saures Stoppbad zu verwenden, weil es nie schaden kann. Ob eine Filmentwicklung durch ein Stoppbad in 15 Sekunden gestoppt wird (lt. Steve Anchell’s Darkroom Cookbook) oder durch eine kurze Wässerung in 30 Sekunden, ist fast egal. Das geht in den Streuungen des gesamten Prozesses sowieso unter. Wichtig ist lediglich, dass man es immer gleich macht. Die Pro- und Kontra-Diskussionen über ein saures Stoppbad in allen(!) Fotolaborforen sind daher sinnlos, weil es bei der Filmverarbeitung einfach keine wirklich stichhaltigen Begründungen dafür oder dagegen gibt, außer dass man es so gelernt und immer schon so gemacht hat.
Lediglich in einer mir bekannten Ausnahme sollte man auf ein saures Stoppbad und Fixierbad verzichten und mit Wasser zwischenspülen: bei Pyro-Entwicklern. Die Anbieter dieser Entwickler raten von sauren Bädern ab, weil die Säure den “stain” auflösen könnte. Daher kombiniert man diese Entwickler am besten mit neutralen oder alkalischen Fixierbädern oder dem Fixierer aus dem C41 Farbnegativprozess. Auch dort würde Säure den eingelagerten Farbstoffen schaden.
Eine Zwischenwässerung ist ebenfalls angesagt, wenn man in selbst angerührtem Caffenol entwickelt. Ein direkt nach dem Kaffee eingefülltes Stoppbad hätte sonst eine üble Verfärbung und sähe nicht mehr sehr vertrauenerweckend aus, auch wenn das die Wirksamkeit nicht beinflusst.
Bei der Papierverarbeitung ist gemäß alter Agfa-Empfehlung ein saures Stoppbad grundsätzlich immer anzuraten, was ich zumindest für PE-Papiere empfehle. Damit wird vermieden, dass allzu viel basischer Entwickler ins meist saure Fixierbad verschleppt wird und dieses zusätzlich belastet. Ein schnelles Abstoppen des Entwicklungsprozesses ist im Gegensatz zur Filmverarbeitung hier nicht relevant. Papier wird im Gegensatz zu Film grundsätzlich bis zur Maximalschwärze in den Schatten ausentwickelt, also so lange, bis sich nichts mehr ändert.
Bei Verarbeitung von Barytpapieren gelten etwas andere Regeln, nach denen saure Bäder den Wässerungsprozess erschweren. Hier sind alkalische oder zumindest neutrale Fixierbäder vorzuziehen, die natürlich auch bei PE-Papier verwendet werden können. Beim Papierprozess wird relativ viel Chemie von einem Bad ins nächste verschleppt. Um den pH-Wert in diesem alkalischen Fixierbad zu erhalten, sollte man auf ein saures Stoppbad verzichten und stattdessen kurz zwischenwässern (schreibt Steve Anchell in seinem “Darkroom Cookbook”). Für die Frage „saures Stoppbad ja oder nein“ gibt es beim Positiv-Prozess also unterschiedliche Empfehlungen für PE (ja) und Baryt (nein).
Auf eine bestimmte Verweildauer der Blätter im Stoppbad habe ich noch nie geachtet. Ich tauche die Bilder nur vollständig unter und schwenke ca. 10 Sekunden lang (= Mindestzeit lt. Ilford) ein wenig hin und her, um den basischen Entwickler zu neutralisieren und oberflächlich abzuspülen. Für mich gibt es noch einen weiteren Grund, warum ich bei PE-Papier immer ein saures Stoppbad verwende. Die meisten Papierentwickler enthalten Sulfit, das mit Säure unter anderem zu Schwefeldioxid reagiert, und das stinkt ätzend! Das stinkende, selbst angesetzte Zitronensäure-Stoppbad kippe ich nach jeder Laborsitzung in den Ausguss. Das saure Fixierbad dagegen entsorge ich erst, wenn es laut meiner Strichliste erschöpft ist. Mit Wasser als Stoppbad hätte ich ein stinkendes Fixierbad.
Ein Stoppbad kann man leicht selbst ansetzen: entweder auf 2% verdünnte Essig-Essenz (80ml 25%-ig + 920ml Wasser) oder Zitronensäurepulver aus dem Drogeriemarkt (20g = 1 leicht gehäufter Esslöffel pro Liter). Beide fangen nach kurzer Zeit an, nach Schwefeldioxid zu stinken, Essig-Stoppbad stinkt zusätzlich auch noch nach Essig. Damit riskiert man sicher noch keine Atemwegsverätzungen - es stinkt eben. Bei gekauften Stoppbad-Konzentraten habe ich das noch nicht festgestellt. Die Hersteller tun da zusätzlich irgendwas rein, das SO2-Ausdünstungen verhindert. Stoppbad aus dem Fotolaborhandel enthält meist auch noch einen Indikator, dessen Farbe bei Erschöpfung umschlägt. Das ist gut gemeint, aber bei Laborbeleuchtung kann man diesen zarten Farbumschlag in der Schale nicht sehen.
Wie lange muss ich wässern?
Für Filme hat sich allgemein die folgende von Ilford entwickelte Methode bewährt:
1. Dose einmal mit klarem Leitungswasser (ca. 5°C) durchspülen,
2. Dose mit Wasser füllen, 5x kippen, leeren,
3. Dose mit Wasser füllen, 10x kippen, leeren,
4. Dose mit Wasser füllen, 20x kippen, leeren,
5. Dose letztmals mit frischem Wasser füllen, einige Tropfen →Netzmittel dazu - fertig!
Unter ständig fließendem Wasserstrahl zu wässern ist erstens Verschwendung und zweitens nicht so wirkungsvoll wie der mehrmalige vollständige Wasserwechsel.
Mit einer etwas höheren (d.h. handwarmen) Temperatur kann man die Wässerung noch verbessern bzw. beschleunigen. Wichtiger als die Temperatur ist aber eine kontinuierliche Bewegung, um Konzentrationsunterschiede an der Filmoberfläche auszugleichen. Das ist auch der Grund für das ständige Kippen bei der Ilford-Wässerungsmethode. Die Anzahl der Kippvorgänge entspricht etwa der Zeit, die nötig ist, bis die Fixierer-Konzentrationen in der Gelatine und im Wasser sich halbwegs angeglichen haben. Wichtig ist bei der Ilford-Methode auch, dass die Dose beim Wasserwechsel gut entleert wird. Die Restmenge Thiosulfat in der Emulsion ist am Ende sicher im niedrigen Nano-Gramm-Bereich.
Mangels eigener Erfahrung sage ich hier mal lieber nichts zur Wässerung oder gar Trocknung von Baryt-Papieren. Als jugendlicher, begeisterter Fotofan habe ich mich nur allzu lange damit herumgeärgert (meine persönliche Meinung). Andere wiederum schwören darauf, und für sie kommt nichts anderes als Baryt in Frage. Die immer beschworene „ewige“ →Haltbarkeit ist jedoch auch bei Baryt-Papieren nur nach einer Schwefel-Tonung gegeben.
Für PE-Papiere gibt es unterschiedlichste Empfehlungen.
Nur bei Ilford gibt es klare Anleitungen: ein 15 Sekunden langes Abspülen unter fließendem Wasser.
Bei Wässerung in der Schale oder einer Entwicklungstrommel mit relativ wenig Wasser genügen
lt. Ilford
bei ständiger Bewegung 3x je 15s mit zweimaligem Wasserwechsel.
Der vollständige Wasserwechsel ist dabei viiiel wichtiger als eine große Wassermenge!
In der Praxis ist es mühselig, jedes Bild einzeln zu wässern. Eine übermäßig lange Nasszeit sollte man auch vermeiden,
da sich der Papierfilz sonst von der Schnittkante her vollsaugt, was nach dem Trocknen für schlechte Planlage sorgt.
Daher sammle ich einige Bilder im Spülbecken bzw. in einer Wässerungswanne.
Danach wird es bei mir ohnehin Zeit für eine kleine Pause, um den kleinen Laborraum durchzulüften.
Vor allem die Ausdünstungen des Stoppbads sorgen für schlechte Luft.
Das Wasser im Spülbecken wird jetzt 2× gewechselt, und dann kommen die Bilder mit Wäscheklammern an die Trockenleine.
Ein abschließendes Netzmittelbad ist bei Papieren nicht notwendig, schadet aber auch nicht.
Wie gesundheitsschädlich ist Fotochemie?
Das einzige, was im SW-Labor wirklich giftig ist und Schutzhandschuhe erfordert, sind die wenigen Filmentwickler auf der Basis von Brenzcatechin (z.B. Tanol) oder Pyrogallol (z.B. PMK). Wenn man diese vermeidet, ist der Rest - und das ist fast alles - relativ harmlos, im Gegensatz zu so manchem Haushaltsreiniger. Auch Zitronensäure im Zwischenbad ist prinzipiell ätzend! Zu einem gewerblichen Entkalker, der „nur“ Zitronensäure enthält, gibt es z.B. ein 9-seitiges Sicherheitsdatenblatt. Der ansonsten gefährlichste (weil angeblich krebsfördernde) Stoff in vielen Entwicklern ist Hydrochinon, das vor Kurzem noch in Hautcremes und Haarfärbemitteln verwendet wurde. So schlimm scheint das also auch nicht zu sein, und dass man davon nicht naschen soll, ist hoffentlich klar.
Generationen von Fotolaboranten haben ihre Bilder mit bloßen Fingern in den Schalen bewegt. Und passiert ist: nix! Angsthasen in Foren empfehlen ernsthaft Schutzanzug, Schutzbrille, Einmalhandschuhe und Atemmaske. Wer mit seinen Entwicklerbädern so um sich spritzt, dass er eine Schutzbrille braucht, sollte sich ein anderes Hobby suchen. Jetzt gibt es natürlich zu bedauernde Zeitgenossen, die gegen alles Mögliche allergisch reagieren. Das merken die aber sehr schnell und fassen die nassen Bilder eben ausschließlich mit Laborzangen an. Das mache ich natürlich auch, aber ich gerate jetzt nicht in Panik, wenn ich mal einen Tropfen abbekomme. Für solche Zwecke habe ich ein Waschbecken zum Abspülen in der Nähe oder eine Rolle Küchenpapier zum Abtupfen und gut isses.
Ein Arbeitsschritt, bei dem ich vorsichtig bin, ist lediglich das Ansetzen von Pulverentwicklern zur Stammlösung. Damit man möglicherweise entstehenden Staub nicht einatmet, sollte man das nicht in der Küche, sondern draußen auf Terrasse oder Balkon erledigen, oder die Behälteröffnung mit einem feuchten Tuch etwas abdecken. Das ist nicht nötig bei staubfreien und leicht löslichen Pulverentwicklern mit der Adox Captura® Technik, wie z.B. auch beim neuen XT-3, dem perfekten Xtol-Ersatz.
Empfindlichen Personen können die leicht ätzenden Ausdünstungen aus sauren →Stoppbädern Schwierigkeiten bereiten. Der anerkannte Fachbuchautor Steve Anchell schreibt in seinem Darkroom Cookbook: “The fumes which emanate from acetic acid stop baths are perhaps the single greatest health hazard in the darkroom.” In diesem Fall empfehle ich Stoppbad-Konzentrate aus dem Fotolaborhandel. Die tun da noch irgendwas rein, um diese Schwefeldioxid-Ausdünstungen zu verhindern.
Achtung: Das hier Geschriebene ist keine amtliche Empfehlung, sondern meine Meinung und basiert auf meiner Erfahrung. Wer Schutzausrüstung möchte, soll sie gerne verwenden. Aber für deutlich gefährlicher als gelegentliche Arbeit im Hobby-Fotolabor halte ich den Laserdrucker am Arbeitsplatz, das Einatmen von Stadtluft, die Bewegung im öffentlichen Verkehr, den Verzehr von Fleisch aus Bratpfanne oder Grill, sowie das Trinken von Limonade oder Alkohol - Prost :-)
Wohin mit den verbrauchten Chemikalien?
Wenn ich mir vorstelle, was aus vielen Haushalten und Kleingewerbe alles an Chemie in den Kläranlagen landet (Abflussreiniger, Pinselreiniger, Haarkosmetik mit und ohne Silikon …), könnte man meinen, es kommt auf das bisschen Fotochemie nicht mehr drauf an. Das sagen aber alle anderen auch, die immer noch jeden Samstag ihr Auto-Waschwasser in den Gully vor der Garage laufen lassen. Es muss daher jeder selber entscheiden.
Wenn man die in Plastikkanistern gesammelte Chemie zur lokalen Sondermüllabgabestelle bringt, schreibt man am besten gleich die EAK-Schlüsselnummern des europ. Abfallkatalogs drauf. Diese Schlüsselnummern sind zwar für gewerbliche Anlieferer vorgesehen, aber ein geschulter Mitarbeiter sollte etwas damit anfangen können. Die Anlieferung von Kleinmengen erfolgt in Plastikkanistern, die üblicherweise auch dort verbleiben.
Nach Aussage von einschlägigen Chemie-Experten gilt für Fotochemie-Abfälle:
- verbrauchtes Stoppbad: ist genau so unschädlich wie Reste von saurem Salatdressing, also ab in den Gully,
- verbrauchter Farb- oder SW-Entwickler: EAK 090101 - oder bei Kleinmengen ab in den Gully. Entwickler ist nach kurzer Strecke im Abwasserkanal sowieso abgeranzt und unschädlich. Nicht umsonst brauchen wir etliche Tricks, um ihn vor allzu schneller Oxidation zu schützen.
- verbrauchtes Fixierbad: Sondermüll EAK 090104. Die enthaltenen Silberverbindungen killen Bakterien, bei entsprechend hoher und unwahrscheinlicher Konzentration auch die in der Kläranlage. Üblicherweise kam früher das Fixierbad von der Sammelstelle in eine Silberrückgewinnung, wenn eine nennenswerte Menge aus gewerblichen Laboren, Industrie oder Kliniken zusammenkam. Dort ist wohl überall der analoge Röntgenfilm durch Digitaltechnik ersetzt worden. Für die paar Liter, die wir als Amateure dort abgeben, kriegen wir sicher nix!
- verbrauchter Selen-Toner: Sondermüll EAK 090104 (lt. Moersch oder Adox Sicherheitsdatenblatt), wird also spätestens in der Sammelstelle mit dem Fixierer und allen anderen Metallsalzlösungen zusammengekippt,
- verbrauchtes Bleich- und Bleichfixierbad: Sondermüll EAK 090105
Gebrauchten Selentoner kann man übrigens filtern und wieder auffrischen, dann hält er quasi ewig und muss nicht ständig entsorgt werden: siehe Capacity of Selenium Toner.
Die Abgabe am Schadstoffmobil wird je nach Land/Gemeinde unterschiedlich gehandhabt. Oft wird einfach alles zusammengekippt und landet unter gigantischem Energieaufwand in der Hochtemperaturverbrennung.
Das chemische (mit Natriumdithionit) oder elektrolytische Fällen von Silber aus verbrauchten Fixierbädern ist für Amateure finanziell uninteressant, außer man hat richtig viel Durchsatz und kennt einen Silberschmied mit Schmelztiegel. Unabhängig von der gewählten Methode macht der entstehende schwarze Silberschlamm eine Riesensauerei. Der eigentliche Vorteil dieser Silberfällung ist, dass der verbleibende Fixierbadrest guten Gewissens in den Gully darf.
Was ist bei Ansatz und Lagerung von Pulver-Entwicklern zu beachten?
Etliche bewährte Filmentwickler (ID11, D-76, Xtol, XT-3, A49, Microphen, …) gibt es nur in Form von Pulvertüten zum Selbstanrühren. Im Gegensatz zu vielen Flüssigkonzentraten ist die Haltbarkeit in noch verschlossenen Tüten deutlich länger, aber nicht alle Hersteller versprechen hier eine unbegrenzte Haltbarkeit. Man sollte vor dem Ansetzen auf Verklumpungen oder Verfärbungen achten. Eine verdächtige Schwachstelle sind die Schweißnähte der Plastiktüten.
Ich rate grundsätzlich davon ab, Chemie ebenso wie Filme oder Fotopapier in größeren Mengen auf Vorrat zu kaufen. Die persönliche Arbeitsweise oder das angestrebte Ergebnis können sich mit der Zeit ändern. Dazu kommt möglicherweise noch die Experimentierlust. Für all das sind aufzubrauchende und eventuell schon angegammelte Lagerbestände sehr behindernd.
Das Auflösen der Pülverchen funktioniert normalerweise ohne Probleme laut Gebrauchsanweisung. Am einfachsten gelingt das bei Adox dank deren Captura®-Technologie. In Fotolaborforen (nur dort!) wird dazu oft die Verwendung von entkalktem Wasser empfohlen. Dieses Gerücht schreibt einer vom anderen ab. Ilford empfiehlt für den Entwickleransatz sogar eine mittlere Wasserhärte von 100-300 ppm Calciumcarbonat. Erst bei einer extremen Wasserhärte von deutlich über 300 ppm (= 3 mmol/l oder 17° dH) raten sie zu enthärtetem Wasser. Jeder fertig konfektionierte Entwickler muss daher für Ansatz in Leitungswasser geeignet sein, außer in der Anleitung ist explizit etwas anderes gefordert. Ausnahmen gelten auch für selbst angesetzte Entwickler ohne Komplexbildner und Photocalgon (kein! Calgon für die Waschmaschine).
Achtung: „Destilliertes Wasser“ aus dem Baumarkt darf wohl nach DIN so genannt werden, ist aber lt. Datenblatt nur demineralisiert und nicht keimfrei (auf keinen Fall trinken). Die bei der Herstellung verwendeten Ionenaustauscher sind bei mangelnder Wartung ideale Brutstätten für alles Mögliche. Mit Baumarkt-Wasser angesetzt, hatte ich schon mehrfach nach wenigen Wochen Lagerzeit weiße Schimmelflocken, die im Entwickler herumgeschwommen sind. Mit Leitungswasser angesetzt (bei 2,4 mmol/l = 13,5°dH an der Grenze zwischen mittel und hart), waren meine Entwickler immer einwandfrei.
Wichtig ist, danach den frisch angesetzten Entwickler in gasdichten Flaschen vor Oxidation zu schützen. Ungeeignet für die Lagerung sind die Plastikflaschen, in denen Fixierbad- und Entwicklerkonzentrate ausgeliefert werden. Diese bestehen meist aus HDPE, sind damit zwar für den Transport unzerbrechlich, aber NICHT ausreichend gasdicht. Solche Flaschen taugen lediglich zur Lagerung von Fixierbad, das wenig Sauerstoff-empfindlich ist. Zur Lagerung von Entwickler wären gasdichte PET-Getränkeflaschen theoretisch geeignet. Aber die Verwendung von Lebensmittelflaschen für Chemikalien ist absolut tabu.
Die optimale Lagerung für Entwickler ist in braunen Glasflaschen, die es unter der Bezeichnung „Aponorm-Flasche“ in verschiedenen Größen für wirklich wenig Geld in jeder Apotheke gibt. Zuerst fülle ich den nach Herstelleranleitung frisch angesetzten Entwickler in 8 Fläschchen mit 100ml Nenngröße, über die Füllmarke hinaus bis 1cm unter den Rand. Dies entspricht etwa 120-125 ml (Mindestmenge bei Xtol wären 100 ml je Film). Die schädliche Sauerstoffmenge ist nur gering, mit Schutzgas fange ich da erst gar nicht an. Der Rest der Entwickler-Vorratslösung lagert in vollen Literflaschen. Eine 120ml-Entwicklerportion wird zum späteren Gebrauch mit temperiertem Leitungswasser verdünnt auf 250ml. Man hat damit ausreichend genau die Verdünnung 1+1 als Einmalentwickler für 1 KB-Film in der 1500er-JOBO-Dose. Wenn nach einigen Filmen alle Fläschchen leer sind, wird die nächste Literflasche umgefüllt.
Auf diese Weise versprechen die Hersteller eine Haltbarkeit von ½ Jahr, was als sicheres Minimum anzusehen ist. Aus langjähriger Erfahrung kann ich 1 Jahr Haltbarkeit für Xtol bestätigen, und das bei Ansatz mit Leitungswasser und Lagerung bei Raumtemperatur. Um auf Nummer sicher zu gehen und weil Xtol (oder auch D-76) so billig ist, würde ich die Reste nach 1 Jahr grundsätzlich ins Klo kippen und neu ansetzen. Bei Adox Atomal 49 werden dagegen für die Haltbarkeit der Stammlösung nur 6 Wochen angegeben. Umweltauflagen haben hier eine Änderung im Vergleich zum alten Calbe A49 erzwungen. Ein 5‑Liter-Ansatz A49 ist daher nur etwas für Großverbraucher.
ACHTUNG: Glasflaschen nie bis zum Rand voll machen! Durch Wärmedehnung bei sommerlichen Temperaturen könnten diese sonst platzen, was eine Riesensauerei gäbe.
Um einen einzelnen 120er Rollfilm zu entwickeln, verdünne ich ein Fläschchen Entwickler mit 290ml Wasser und habe dann eine ausreichende Gesamtmenge von 410 ml als Ansatz 1+2,4. Im Vergleich zur bewährten Entwicklungszeit für den Ansatz 1+1 verlängere ich die Entwicklungszeit um den Faktor 1,35 (gilt für HP5 in Xtol). Kodak warnt davor, den Xtol-Ansatz nach einem halben Jahr noch in Verdünnungen höher als 1:1 zu verwenden (Stichwort: →sudden death). Bei mir hat Xtol bisher immer problemlos entwickelt, und ich verzichte seit Jahren auf den →„Schnipseltest“.
Noch ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang: Die in vielen Gebrauchsanweisungen beschriebene unverdünnte Verwendung der Entwickler-Stammlösung mit anschließendem Zurückgießen in die Vorratsflasche ist für Hobbylaboranten auf keinen Fall zu empfehlen! Warum es trotzdem in den Datenblättern zu finden ist, kommt wohl von der Arbeitsweise der Großlabore, die einen kontinuierlich regenerierten Entwickler im Tank haben und selten komplett neu ansetzen. Die gelegentliche Entwicklung von einzelnen Filmen mit Hilfe dubioser Verlängerungsfaktoren kann im Hobbylabor niemals reproduzierbare Ergebnisse bringen. Vorzuziehen ist grundsätzlich die Verwendung solcher Stammlösungen als Einmalentwickler z.B. in der Verdünnung 1+1. Ausgenommen von dieser Warnung sind natürlich die völlig anders arbeitenden Zweibadentwickler, wie z.B. Diafine oder Moersch MZB.
Wie lange halten Entwicklerkonzentrate?
Eine praktische Alternative zu Pulverentwicklern sind Entwicklerkonzentrate,
die nicht mühsam angerührt, sondern nur gemäß Gebrauchsanweisung mit Wasser verdünnt werden müssen.
Über die Haltbarkeit von solchen Konzentraten gibt es sehr widersprüchliche Meinungen.
Wirklich wichtig ist, dass für eine längerfristige Aufbewahrung nicht die unzerbrechlichen Plastikflaschen verwendet werden,
die für Vertrieb und Versand vorgesehen sind. Die optimale Aufbewahrung hat immer(!) in gasdichten Glasflaschen zu erfolgen.
Meine Empfehlung wären die in jeder Apotheke günstig und in verschiedenen Größen erhältlichen braunen Aponorm-Flaschen.
Die Original-Rezepturen von Rodinal und dem alten, sirup-artigen Kodak HC-110 (geänderte Rezeptur seit 2019)
waren Konzentrate mit anerkannt guter Haltbarkeit.
Ilford traut einer ungeöffneten(!) Flasche Ilfotec-HC sogar eine unbegrenzte Lebensdauer zu.
Mirko (Analog-Spezialist und Geschäftsführer bei Fotoimpex) hat die Zusammenhänge schön dargestellt,
bitte hier klicken: Haltbarkeit von Entwicklerkonzentraten
Sonstige Fragen zur Fotografie
Welches Stativ soll ich kaufen?
Ein Einbein-Stativ sieht so professionell nach Reporter aus, bringt aber nicht viel - und ist auch nicht besser als die Rolleiflex auf meinem Bauch-Stativ als Bohnensack-Ersatz :-), d.h. ich rate eindeutig davon ab. Zum Fotografieren ist sowas die Schlepperei nicht wert. Gegen die Wackelei mit einer Filmkamera mag so ein Einbein vielleicht helfen. Reporter benutzen das Einbein nur deswegen, damit ihnen beim stundenlangen Halten ihrer Profikameras samt Paparazzi-Objektiv nicht die Arme lahm werden.
Wenn man meint, ein richtiges Foto-Stativ zu brauchen, muss man gleich ordentlich klotzen und anschließend auch immer ordentlich schleppen. Möglichst geringes Gewicht und gleichzeitig möglichst große Steifigkeit sind nun mal physikalische Gegensätze, gegen die keinerlei Marketing hilft. Ein Stativ meines Vertrauens wäre ein solides Holzstativ mit optimalen Dämpfungseigenschaften (z.B. von Berlebach, Wolf, …), und das muss dann auch noch auf einem festen Untergrund stehen. Das massivste, was ich bisher gesehen habe, sind wohl die amerikanischen Ries-Stative. Eigene Erfahrungen damit habe ich natürlich nicht. Auch der aus Carbon-Fasermaterial hergestellten Stativ-Edelklasse traue ich gute Eigenschaften zu. Die sind zwar besonders leicht (was schlecht ist für die Eignung als Stativ), dafür aber auch extrem steif (was wieder gut ist).
Ein Standard-Dreibein zum Amateur-Preis ist gut für Gruppenbilder mit Blitz und Selbstauslöser. Solche Stative taugen ansonsten nur für nahezu erschütterungsfreie Zentralverschluss-Kameras oder eingeschränkt für KB-Spiegelreflexkameras in Kombination mit Spiegelvorauslösung. Beim Verschluss einer Kiev 60 würde auch eine optionale Spiegelvorauslösung nicht viel helfen.
Bei Langzeitaufnahmen (d.h. länger als 1/60 s) habe ich schon einige Enttäuschungen erlebt. Sicher ist man erst bei Belichtungszeiten von mindestens 1s, weil dann die Vibrationen aus Spiegel- und Verschlussablauf ausschwingen können und ihren Störeinfluss hoffentlich nur während eines kleinen Teils der Gesamtbelichtungszeit ausüben. Ich empfehle daher, mit einem billigen Stativ den Zeitenbereich 1/2 bis 1/30s grundsätzlich zu vermeiden. Wozu aber auch ein einfaches Dreibein allemal gut ist, ist die Bildgestaltung. Das macht dann den Unterschied zwischen Knipsen und Fotografieren. So betrachtet bin ich fast ausschließlich ein Knipser und kein Fotograf.
Ich selbst habe: Manfrotto 680B Einbeinstativ und das Manfrotto 055PROB Dreibeinstativ mit Kugelkopf 468RC2 oder 3D-Neiger 460MG mit PL200 Schnellwechselplatten. In letzter Zeit hatte ich nur noch den 3D-Neiger drauf. Mit Kugelkopf bin ich eindeutig schneller, aber mit 3D-Neiger kann ich den Ausschnitt um die drei räumlichen Drehachsen herum präziser einstellen. Weil ich mit Stativ ohnehin keine Schnappschüsse mache, muss es auch nicht so schnell gehen.
Wo bekomme ich Ersatz für die Quecksilberbatterien?
Das hat jetzt nichts mit Schwarzweiß und analoger Fotografie zu tun. Aber wer schwarzweiß knipst, steht im Verdacht, dass er seine Uralt-Kameras oder -Belichtungsmesser immer noch benutzt, und dann hat er wahrscheinlich dieses Problem. In absehbarer Zeit wird sich dieses Problem jedoch in Luft auflösen. Der typische Belichtungsmesser bis etwa 1975 bestand aus der Kombination von reaktionsträgem CdS-Fotowiderstand und 1,35V-Quecksilber-Knopfzelle. Vor allem bei wenig Licht hat das Zeigerinstrument laaaange gebraucht, bis ein stabiler Wert angezeigt wurde. Schon allein aus diesem Grund rate ich heute vom Kauf solcher alten Geräte ab, außer man möchte sie in eine Sammlervitrine legen. Man hat stets das Risiko, dass der Fotowiderstand aus Altersgründen allmählich seinen Geist aufgibt. Spätere Entwicklungen hatten SBC Silizium-Messzellen und einen dazu notwendigen Messverstärker, der dank Einführung von Microprozessoren zu kostengünstigen Belichtungsmessern und reaktionsschnellen Belichtungsautomatiken geführt hat.
Die Quecksilberzelle PX625 (oder die seltenere PX675) hatte die Eigenschaft, während ihrer langen Lebensdauer konstant 1,35V abzugeben. Ohne aufwändige Spannungsregelung oder Brückenschaltung konnte man damit billigst präzise Belichtungsmesser herstellen. Sogar den Batterietestknopf konnte man einsparen. Der Belichtungsmesser hat funktioniert - oder mit leerer Batterie ziemlich plötzlich nicht mehr.
Ich habe hier mehrere Möglichkeiten für einen Ersatz der alten Queckies zusammengefasst. Damit funktionieren diese Belichtungsmesser wieder wie sie sollen, nur bei wenigen Ausnahmen muss ich wegen altersbedingter Dejustierung die einzustellende Filmempfindlichkeit um 1-2 DIN korrigieren. Eine darüber hinausgehende Abweichung deutet vermutlich schon das nahende Ende der CdS-Messzelle an.
Lösung a) Es gibt günstige Alkali-Knopfzellen PX625A = V625U = LR9, die in den Abmessungen mit der PX625 identisch sind. Neue Alkalizellen haben eine Anfangsspannung von 1,55V, die aber nicht konstant bleibt, sondern während der Lebensdauer kontinuierlich abfällt. Falls die Kamera eine Spannungsregelung oder Brückenschaltung aufweist (z.B. Pentax Spotmatik, Canon EF, Rollei 35SE/TE, sowie diverse Prakticas) ist die genaue Spannung egal, und wir haben mit einer Alkali-Zelle, die lediglich in den Abmessungen passen muss, einen perfekten und kostengünstigen Ersatz. Als Ersatz für die PX400 (blauen Kunststoffring weiter verwenden!) in der Spotmatik benötigt man die in den Abmessungen kompatible Uhrenbatterie SR45 (=V394). Ob der Belichtungsmesser auch mit der etwas höheren Spannung richtig anzeigt, stellt man am besten durch Vergleichsmessungen mit einem vertrauenswürdigen Referenzgerät fest (keine Digitalkamera, da die ISO-Empfindlichkeit dort anders definiert ist). Die meisten alten Kameras haben keine Brückenschaltung und werden infolge dieser Überspannung falsch anzeigen. Das trifft leider auch auf ehemals hochwertige Profigeräte zu (wie z.B. Canon F1, Leicaflex SL, Leica M5, Olympus OM1, Gossen Lunasix). Der Messfehler ist über den Messbereich nicht konstant und kann daher auch nicht durch eine geänderte ISO-Einstellung kompensiert werden. Bei meiner →Canon FTb lag dieser Messfehler mit frischer Alkali-Knopfzelle je nach Helligkeit zwischen 1 bis 2,5 Blendenstufen Unterbelichtung. Das wäre auch für ansonsten sehr tolerante SW-Filme zu viel.
Auch die im Außendurchmesser kleinere Knopfzelle LR44 tut es (kombiniert mit einem gebogenen Ring aus Elektronik-Basteldraht, der nur als mechanischer Adapter zur Durchmesser-Anpassung dient). Leider funktioniert das nicht bei meiner alten Canon EF, die für den Masse(minus)-Kontakt tatsächlich den passenden leitenden Durchmesser braucht. Damit ich die in jedem 1€-Shop oder Drogeriemarkt billig erhältliche LR44 verwenden kann, setze ich diese in eine ausgehöhlte Blechschale einer verbrauchten PX625A ein.
Lösung b) In jedem Drogeriemarkt gibt es in der 6er-Blisterpackung Hörgerätebatterien Typ 675 (oder PR44). Technisch sind das Zink-Luft-Zellen, die durch Abziehen einer Schutzfolie aktiviert werden müssen, damit durch kleine Luftlöcher Sauerstoff eindringt. Bis zum Lebensdauerende bleibt dann die Spannung von 1,4V ziemlich konstant. Die geringe Spannungsdifferenz zu den 1,35V der alten Quecksilberbatterien ist noch vernachlässigbar. Diese Batterien sind billig und daher ein idealer Ersatz für PX625 und PX675. Damit die 675er besser ins Batteriefach für die etwas größere PX625 passt, verwende ich als Adapter zur Durchmesser-Anpassung einen gebogenen Ring aus 4cm Elektronik-Basteldraht mit PVC-Isolierung.
Leider gibt es einen kleinen Nachteil: Egal ob man Strom abnimmt oder nicht, nach der Aktivierung beginnt der chemische Zerfall der Hörgerätebatterie, und die Lebensdauer ist mit ca. 4-6 Monaten ziemlich kurz. Also muss man immer eine Ersatzbatterie dabei haben oder am besten schon vor dem Urlaub eine neue einlegen. Wichtig ist auch: Diese Batterie braucht Luftsauerstoff. In luftdicht abgeschlossenen Batteriefächern kann es da Probleme geben. Manche alten Kameras haben im Münzschlitz des Batteriefachdeckels bereits ein kleines Löchlein. Falls nicht, muss man beherzt zu Bohrmaschine und 1-2mm-Bohrer greifen.
Lösung c) Es gibt Silberoxidzellen SR44, nicht zu verwechseln mit den oben unter a) genannten, gleich großen Alkalizellen LR44. Diese SR44 haben eine ähnliche Charakteristik wie die alten Quecksilberzellen: konstante Spannung über eine sehr lange Lebensdauer. Leider ist die Spannung mit 1,55V zu hoch, und wir haben in Kameras ohne Brückenschaltung damit wieder einen Messfehler. Mit Hilfe einer kleinen Schottky-Diode BAT83 wird die Spannung auf die erforderlichen 1,35V reduziert. Die Diode muss in Durchlassrichtung eingelötet werden, sodass deren Kathode (die mit Farbring markierte Seite) im Stromkreis zum Minuspol der Batterie weist. Bitte nicht dadurch verwirren lassen, dass die mit dem Voltmeter gemessene Leerlaufspannung immer noch ca. 1,5V beträgt! Beim typischen Strombedarf dieser alten Belichtungsmesser von etwa 75µA passt es genau. Von Frans de Gruijter gibt es eine Bastelanleitung (pdf) für diesen Adapter. Die benötigten Kleinteile habe ich mir problemlos von ihm zuschicken lassen. Außer einem Elektronik-Lötkolben und etwas Feinmechanikerwerkzeug braucht man für diese Frickelei Geduld und eine ruhige Hand. Meine Adapter sind nicht schön geworden, aber sie funktionieren.
Solche Diodenadapter setzen die Spannung der SR44-Zelle von 1,55V nur ungefähr auf die 1,35V der alten Queckies herab. Die tatsächliche Spannung hängt ab von der aktuellen Temperatur und dem Strombedarf der Kamera, der lichtabhängig und damit auch nicht konstant ist. Die Adapter funktionieren auf jeden Fall so gut, dass der Belichtungsmesser im besten Fall gar keine, und wenn, dann eine ausreichend konstante Abweichung hat, die man mit der ISO-Einstellung korrigieren kann. Mit einer SR44 ohne diesen Adapter wäre die Abweichung über den Messbereich auf jeden Fall nicht konstant!
Lösung d) Vielleicht muss das gute Stück ohnehin mal zum Service in eine Fachwerkstatt. Bei dieser Gelegenheit kann man viele alte Kameras mit einem internen Justier-Potentiometer auf SR44 mit 1,55V umstellen lassen. Danach hat man einen sauber justierten und über den ganzen Messbereich wieder zuverlässigen Belichtungsmesser. Mein Lieblings-Kameraschrauber hat dafür einen Aufpreis von 5 € (in Worten: fünf) verlangt. Lediglich wenn der Hersteller den Abgleich mit fest verlöteten Widerständen gemacht hat, wird die Umstellung aufwändig und lohnt sich wahrscheinlich nicht.
Man kann sich als geschickter Feinmechaniker eventuell auch selbst helfen, sogar ganz ohne Kenntnis der Kamera-Elektronik. Wenn man sich zutraut, die Kamera etwas zu zerlegen, ist hinter dem Batteriefach oft noch ausreichend Platz für die bei c) genannte Diode.
Lösung e) Es gibt im Fotohandel die schweineteure “revolutionary new WeinCell MRB625”. Das ist nichts anderes als eine 675er Zink-Luft-Hörgerätebatterie mit einem gestanzten Blechring als Adapter, damit sie in den Einbaumaßen mit der PX625 weitgehend identisch ist. Diese Lösung funktioniert logischerweise genauso gut wie meine Billig-Variante b). Wenn man schon mal auf die Werbung hereingefallen ist und für viel Geld eine solche MRB625 gekauft hat, kann man diesen Ring von der verbrauchten WeinCell abdrücken und anstelle des oben empfohlenen gebogenen Drahtes mit billigen Hörgerätebatterien weiterverwenden!
Hier noch ein weiteres solches Nepp-Angebot, bei dem man nur diese überflüssigen Adapterringe für richtig viel Geld kaufen kann. Diese werden beworben als „unzerbrechliche Präzisionsteile, Tausende zufriedener Kunden, …“ :-)
Lösung f) Für diesen Tipp bedanke ich mich bei
Gervin Griesser (Fotograf und „Funkenschuster“):
Eine Alkalizelle LR44 muss in vielen Anwendungen schon ersetzt werden (z.B. in der LED-Lampe am Schlüsselbund),
wenn die verbleibende Leerlaufspannung auf 1,35-1,38 V gesunken ist.
Mit einem Voltmeter ist das leicht überprüfbar. Genau jetzt ist sie der ideale Quecky-Ersatz.
Da der Stromverbrauch der Belichtungsmesser äußerst gering ist, kann dieser Zustand lange anhalten (bis zu 1 Jahr).
Wenn die Kamera keinen Batterietestknopf hat, sollte man am besten alle paar Monate
mal die Spannung nachmessen. Diese Variante nutzt bei null Zusatzkosten alte Batterien noch aus,
bevor Sie endgültig in der Recycling-Box landen.
Achtung: Silberoxidzellen SR44 mit 1,35V Restspannung sind bereits so gut wie tot
und für diese Methode ungeeignet.
Wie finde ich ein Negativ in meinen Ordnern?
Hier hat wohl jeder seine eigene Methode, d.h. es gibt Tausende unterschiedliche Herangehensweisen. Ich beschreibe hier nur kurz, was sich bei mir bewährt hat.
Nach der Entwicklung der Filme folgt als erstes immer ein Kontaktabzug. Hierzu lege ich die Negativstreifen nahtlos nebeneinander auf ein Blatt 18x24, mein Standardformat. Das reicht für 5 6er-Streifen vom KB-Film oder so gerade noch für 4 3er-Streifen vom 6x6 Rollfilm. Die Negative beschwere ich zur Belichtung mit einer Glasscheibe (für wenig Geld vom Glaser um die Ecke). Für diese Kontakte wähle ich nicht die mittlere Gradation 2, sondern die weichere Grad.1 (wegen Kontrastverstärkung durch den →Callier-Effekt des gerichteten Vergrößererlichts). Die Negative werden dann chronologisch in Pergamintaschen abgelegt und diese Ablageblätter getrennt nach KB/Rollfilm fortlaufend nummeriert. Ein Bogen für KB-Film hat z.B. die Blattnr. 678 und die Negativstreifen mit den Nummern 1-7. Ein Bogen für Rollfilm erhält z.B. die Nummer R567 und enthält die Negative Nr. 1-12 eines gesamten Films. Jedes einzelne Negativ hat damit eine individuelle Nummer, z.B. bei Kleinbildfilm 678-3-2 (Blatt 678, 3. Negativstreifen, 2. Negativ) oder bei 6×6 auf Rollfilm R567-9 (Blatt 567, Negativ Nr. 9).
Nach derselben Systematik beschrifte ich fortlaufend auch die Kontaktabzüge, z.B. 678-6 bis 679-3 (das sind 5 aufeinanderfolgende 6er-Streifen). Bei Rollfilm genügt die Blatt-Nummer, da immer ein kompletter Film drauf ist. Die Kontaktabzüge landen getrennt nach KB/Rollfilm chronologisch in leeren Fotopapierschachteln (davon hat man irgendwann reichlich). Seitlich an der Schachtel beschrifte ich dann Negativnummer von - bis. So habe ich auch einen Überblick, wenn ich vor dem Regal stehe.
Nach einem erfolgreichen Fotolaborabend beschrifte ich die Vergrößerungen auf der Rückseite immer mit der dazugehörigen Negativnummer.
Genauso wichtig ist jetzt noch der letzte Schritt: Ich führe fortlaufend eine chronologische Liste
als simple txt-Textdatei mit ganz wenigen, dafür leicht zu erfassenden Daten. Das Folgende passt alles in eine Zeile:
1. Datum (rückblickend oft nur der Monat)
2. Ort / Personen / Anlass / ...
3. Negativnummer von - bis
Seit 2004 halte ich dieses System konsequent ein und ich habe damit noch nie länger als 2-3 Minuten gebraucht,
um einen Kontaktbogen und ein bestimmtes Negativ zu finden, egal wie alt!
Was sich dabei bewährt hat und was ich daher dringend empfehle:
Ich habe bewusst keine High-Tech-Datenbanksoftware eingesetzt, weil ich keine Lust habe,
nach einem x-ten inkompatiblen Softwarewechsel wieder von vorne anfangen zu müssen.
Wer könnte heute noch Daten im Standardformat der 1980er Jahre (Lotus 1-2-3 oder dBase) lesen und weiterpflegen?
Mein System hat ebenso wie die Negative eine deutlich längere Lebensdauer.
Was ich nicht mache, ist die Registrierung von Kamera, Objektiv, Filmsorte, Belichtungs- oder Entwicklungsdaten, etc. Mir wäre das einfach zu aufwändig, und wenn man das nicht konsequent IMMER macht, kann man's gleich bleiben lassen. Sollte ich derartige Informationen längerfristig für bedeutend halten, notiere ich das auf der Rückseite des Kontaktbogens. Ansonsten erkenne ich die Filmsorte an der Randbelichtung auf dem Kontaktbogen. Der Entwickler (Xtol oder XT-3) ist bei mir seit ca. 20 Jahren und für die Zukunft ohnehin konstant (→Regel Nr. 2). Ich verwende keine schlechten Objektive, und ein gutes Foto macht nicht die Kamera, sondern der Fotograf.
Gerüchte, die ich nicht bestätigen kann!
In den Hobbylabor-Foren melden sich naturgemäß auch viele Anfänger und (Noch-)Laien zu Wort. Daher findet man dort immer wieder mal angelesenes Halbwissen, das dann von Anderen munter ungeprüft abgeschrieben wird. Bei folgenden Punkten handelt es sich eindeutig um Gerüchte, d.h. da ist absolut nichts wahr daran.
a) Ilford Multigrade erreicht keine tiefen Schwärzen, nur Agfa-Papiere „knacken“
In der PE-Ausführung kann ich optimale Abzüge auf beiden Papiersorten in der halbmatten Version (pearl bzw. satin) überhaupt nicht auseinanderhalten, weder optisch noch haptisch. Beide Papiere sind hervorragend. Mangels eigener Erfahrung kann ich zu den Baryt-Ausführungen nichts sagen. Das Gerücht, dass nur Agfa-Papiere knacken, kommt wohl von Anwendern des alten Original-Agfa-Papiers, die nach der Agfa-Pleite auf Ilford-Papier umgestellt haben, ohne Belichtungszeit und Filterung anzupassen. Ilford hat nach 25 Jahren die Fertigung umgestellt auf das neue Multigrade in der 5. Generation, und schon geht es wieder los: „Das neue Papier ist zu hart, wo doch bisher immer alles okay war.“ Jede Papiersorte (genau genommen sogar jede Fertigungscharge) verhält sich eben ein bisschen anders und muss erst neu eingetestet werden. Wenn man ohne Laborbelichtungsmesser nur mit Probestreifen arbeitet, dauert es leider ein bisschen, bis man bei einem anders reagierenden Papier wieder ein intuitives Gefühl für die richtige Filterung entwickelt. Weil Ilford sein Material aber nicht ständig ändert, sondern über Jahrzehnte hinweg mit hoher Konstanz produziert, ist ein erneutes Eintesten auf jeden Fall die geringe Mühe wert.
b) Optimale Negative erhält man nur mit der vom Filmhersteller empfohlenen Chemie
Dazu sage ich nur: Auch andere Mütter haben schöne (schönere?) Töchter. Auch wenn viele davon geschwärmt haben: Was mir z.B. noch nie gefallen hat, war die Kombination Agfa APX in Agfa Rodinal.
c) Beim Entwickler Kodak Xtol riskiert man den “sudden death”
Vorbemerkung: Es scheint definitiv keine Fotochemie der Marke Kodak mehr zu geben, also gibt es auch kein Original Xtol mehr. Alles was auf meinen Seiten über Xtol steht, kann 1:1 auch auf Adox XT-3 angewendet werden.
Wahr ist: Xtol ist, bzw. war nicht weniger haltbar als andere Entwickler, deutete seinen nahenden Tod aber nicht wie viele andere Entwickler durch eine gelbe bis bräunliche Verfärbung an. Das plötzliche Umkippen dieses Standardentwicklers kann man als einen Geburtsfehler bei der etwas überstürzten Markteinführung 1996 betrachten. Kodak hat den Entwickler damals sogar wieder kurzfristig vom Markt genommen. Was auch immer die eigentliche Ursache war, Kodak hat nachgebessert und rät seitdem davon ab, Entwickler-Stammlösung, die älter als 1/2 Jahr ist, in der Verdünnung 1+2 oder 1+3 zu verwenden. Wenn man das beachtet und vor Oxidation geschützt lagert, gibt es definitiv keine Haltbarkeitsprobleme im Vergleich zu Stammlösungen anderer Entwickler. Also immer daran denken: Die →Aufbewahrung des Vorrats erfolgt selbstverständlich nicht in dubiosen Plastikflaschen, sondern z.B. in Aponorm-Glasflaschen, voll mit Xtol bis knapp unter den Rand! So kann man Xtol jahrelang aufbewahren - wahrscheinlich. Bei mir ist er noch nie so alt geworden. Stammlösungen, die nach einem Jahr noch herumstehen, entsorge ich, egal was drin ist. Das gilt erst recht bei einem preisgünstigen Entwickler wie Xtol. Dann kann man sich auch vor jeder Filmentwicklung den „Schnipseltest“ mit dem Filmanschnitt sparen.
Schnipseltest: Um bei altem Entwickler sicherzustellen, dass er überhaupt noch aktiv ist, kann man ein Schnipsel irgendeines Kleinbildfilms in den Messbecher mit fertig verdünntem Entwickler werfen. Nach ca. 2 Min. sieht man schon deutlich die Wirkung, und das war’s. Eine bereits verminderte Aktivität kann man nur am fertig entwickelten Film nachweisen, z.B. durch Vergleich von Dichtewerten mit einer eingetesteten Referenz.
Kodak empfiehlt im Xtol-Datenblatt enthärtetes Wasser, “if your water supply is exceptionally hard (above 200 ppm of CaCO3)”. Das halte ich für einen Druckfehler, da man bei 200 ppm wirklich nicht von außerordentlich hartem Wasser sprechen kann. Ich verwende für den Xtol-Ansatz seit Jahren problemlos Leitungswasser mit 245 ppm. 200 ppm entsprechen einer Wasserhärte, die Ilford sogar ausdrücklich empfiehlt. Erst bei Wasser mit einer extremen Härte deutlich über 17°dH oder 300 ppm Calciumcarbonat rät Ilford davon ab. Von einem generellen Ansatz in enthärtetem Wasser ist entgegen weit verbreiteter Meinung nirgendwo die Rede.
Dann liest man auch manchmal, dass Eisen-Ionen im Leitungswasser schuld sein sollen. Kodak hat die anfängliche Eisen-Problematik angeblich durch Beigabe von Chelat-Bildnern bereinigt. In meinem Haus gibt es definitiv alte Eisenrohre. Ich hatte bisher gelegentlich Probleme mit Rostpartikeln im Leitungswasser, aber noch nie mit umgekipptem Xtol.
Ein Problem mit Xtol haben allenfalls Gelegenheitsknipser mit geringem Filmdurchsatz. Der 5-Liter-Ansatz für mind. 40 Filme mag für solche Anwender etwas viel sein. Dafür gilt mein Tipp, nach einem Jahr jeden(!) Vorrat vorsichtshalber ins Klo zu kippen. Auch dann sind die Entwicklerkosten je Film mit Xtol wahrscheinlich niedriger als mit vielen anderen handelsüblichen Entwicklern.
Als verbesserten Xtol-Nachbau gibt es Adox XT-3 auch in der Liter-Packung, ebenso wie immer schon den Xtol-Klon Fomadon Excel (der sich aber nur mit Geduld vollständig im Ansatzwasser löst). Mit zunehmendem Alter nimmt XT-3 im Gegensatz zu Xtol eine leicht gelbliche Farbe an. Die beiden Entwickler sind also nicht identisch, auch wenn die Entwicklungszeiten und die Ergebnisse identisch sind. Trotz Aufbewahrung in vollen Glasflaschen ist diese Verfärbung deutlich sichtbar. Das Ergebnis mit solchem XT-3 war bisher immer einwandfrei.
d) Alle Belichtungsmesser sind auf 18% Grau kalibriert
Okay, von Kodak gab es mal eine Graukarte, die 18% des einfallenden Lichts reflektiert hat.
Natürlich kann man damit auf die Beleuchtungsintensität schließen, genauso gut kann man
den Belichtungsmesser aber auch auf seine Hand-Innenfläche (ca. 35% Reflexion) oder auf ein weißes Blatt Papier (90%) richten.
Das ist nicht weniger willkürlich als die Messung auf die Graukarte. In all diesen Fällen muss man den Messwert korrigieren
und an den tatsächlich vorliegenden Motivkontrast anpassen.
Belichtungsmesser sind nach Norm auf eine Reflexion von 12,5-16,4% zu kalibrieren.
Das steht so nicht direkt in den Normen, kann man aber aus den Daten rückrechnen.
Die 18%-Graukarte liegt eindeutig außerhalb dieser Norm-Spezifikation.
Leider sagen nicht alle Hersteller von Belichtungsmessern, wie sie diesen Spielraum nutzen, auch wenn es nach Norm im Datenblatt stehen müsste.
Meine Erfahrung ist, dass alle auf ein dunkleres Grau von (je nach Hersteller) 12-14% Reflexion kalibrieren.
Sie orientieren sich damit an einer sommerlichen Freiluftszene in mittleren Breitengraden
(typisches Urlaubsmotiv mit 5,5-6 Blendenstufen Kontrastumfang).
Dass die Messung auf eine 18%-Graukarte bei solchen Motiven nicht zu einer richtigen Belichtung führt,
steht übrigens auch in der Anleitung zur Kodak-Graukarte. Diese war bei ihrer Einführung nur zur Verwendung mit Farbnegativfilm vorgesehen.
Siehe dazu meine →Anmerkungen zur Graukarte
e) Eine Lichtmessung mit dem Handbelichtungsmesser passt immer!
Dass ein Handbelichtungsmesser mit vorgeschobener Diffusor-Kalotte und Licht- statt Objektmessung eine perfekte Belichtung garantiert, steht nur in den Prospekten der Hersteller. Spätestens beim Anblick so mancher vergilbter Plastik-Kalotten sollten einem Zweifel kommen. Normgemäß darf die Anzeige eines Belichtungsmessers 1/2 Blendenstufe daneben liegen, dazu kommen dann noch ±20% zulässige Abweichung durch die Lichtdurchlässigkeit der Kalotte, zusammen also ca. ±⅔ EV oder ±2 DIN Filmempfindlichkeit. Wie mein →Belichtungsmesser-Vergleich zeigt, nutzen einige Belichtungsmesser (keine billigen!) diesen Spielraum auch aus. Das heißt mal wieder: Man muss nicht nur Film und Papier, sondern auch seinen Belichtungsmesser eintesten und dann auf die eigene Prozesskette einjustieren. Perfekt geeignet ist diese Lichtmessung dagegen zur Bestimmung des →Beleuchtungskontrastes. Mehr zu diesem Thema finden Sie in meinen Überlegungen zum →Handbelichtungsmesser.
Copyright © 2009-, Dr. Manfred Anzinger, Augsburg
Stand: , wird gelegentlich korrigiert und bei neuen Ideen fortgesetzt.
